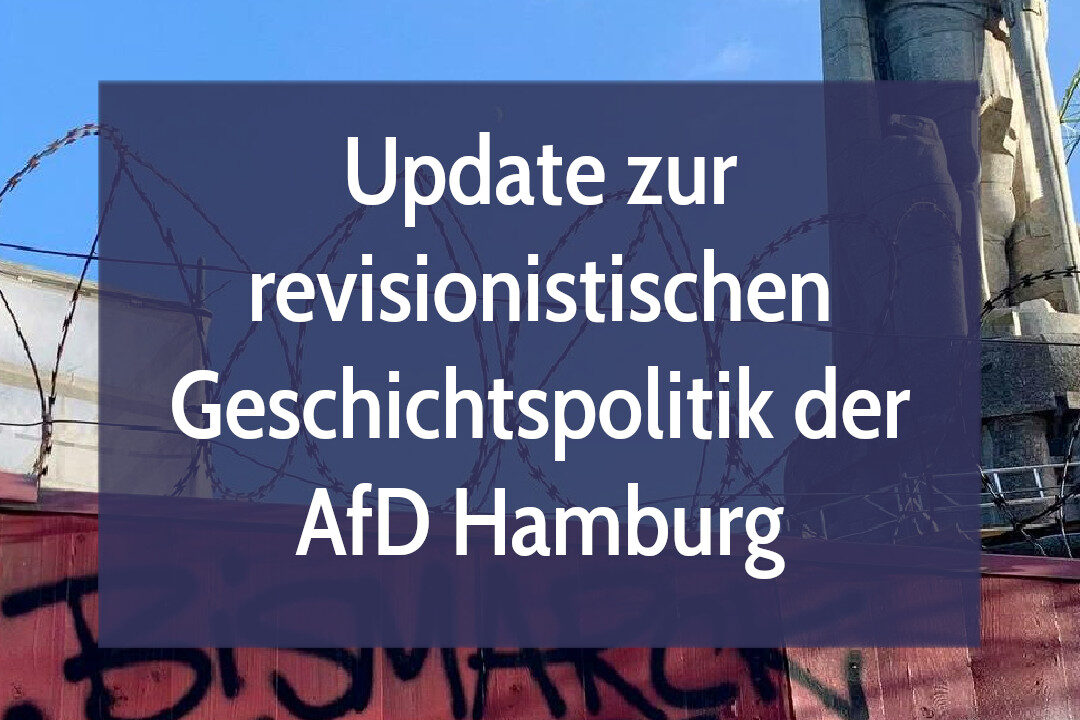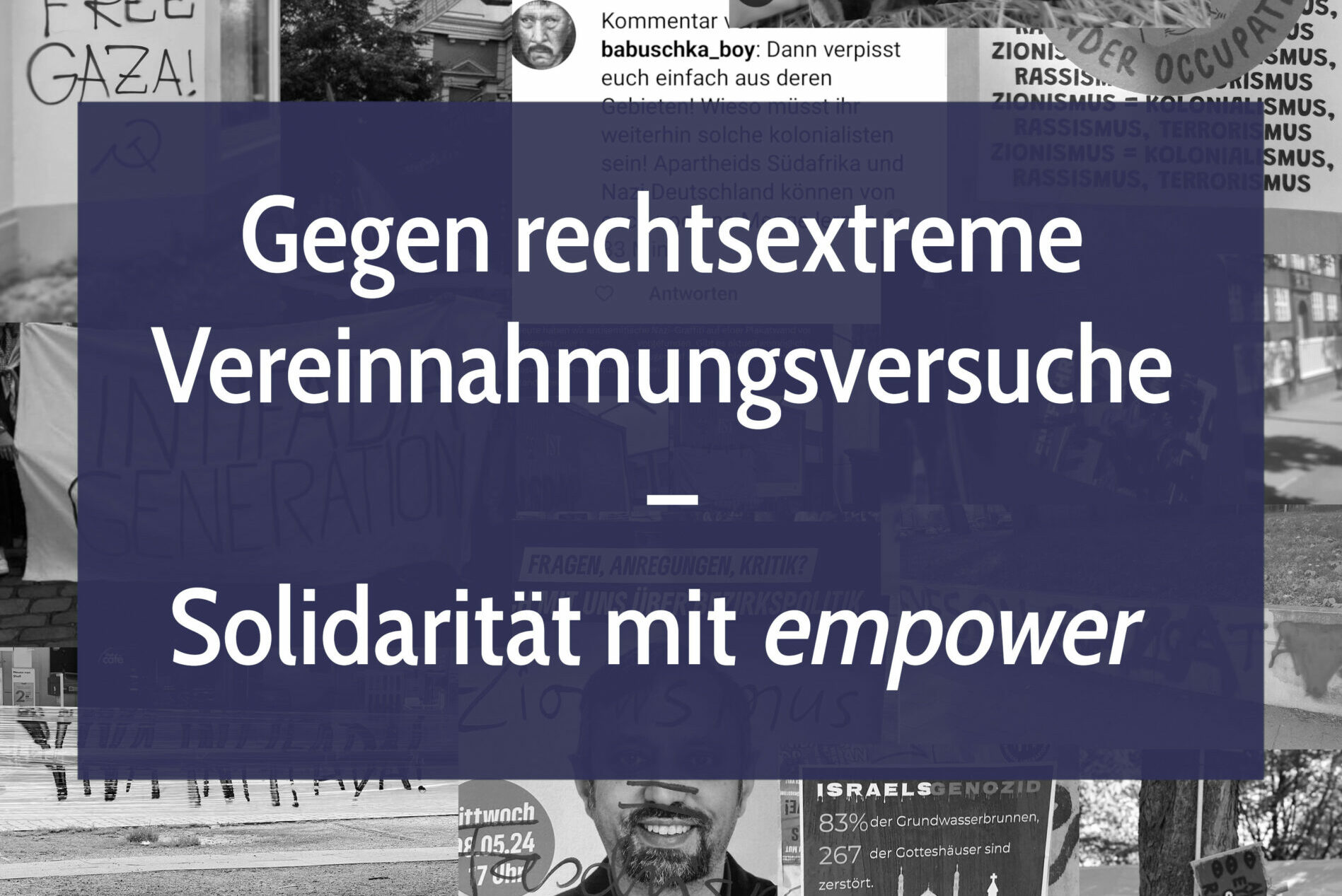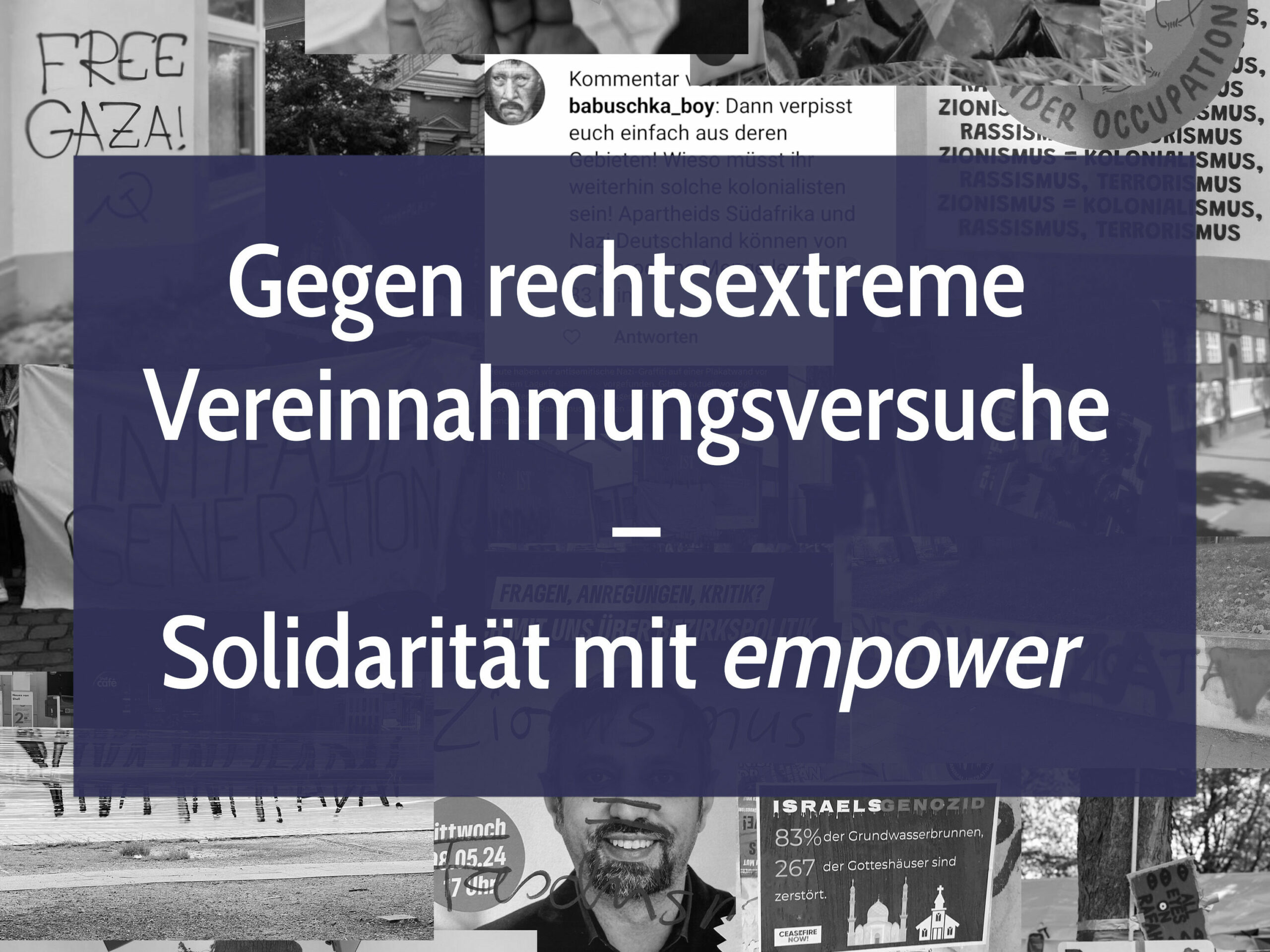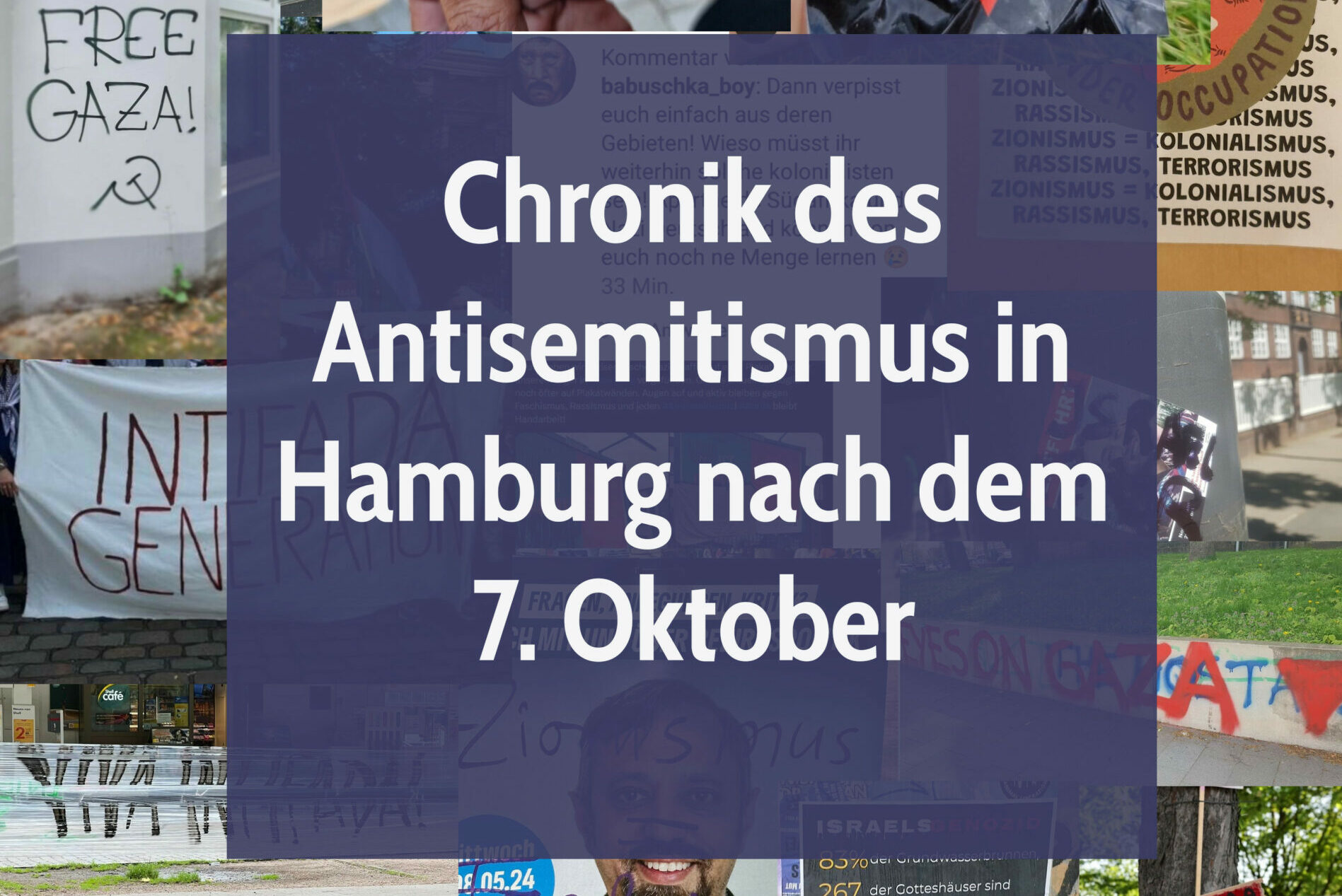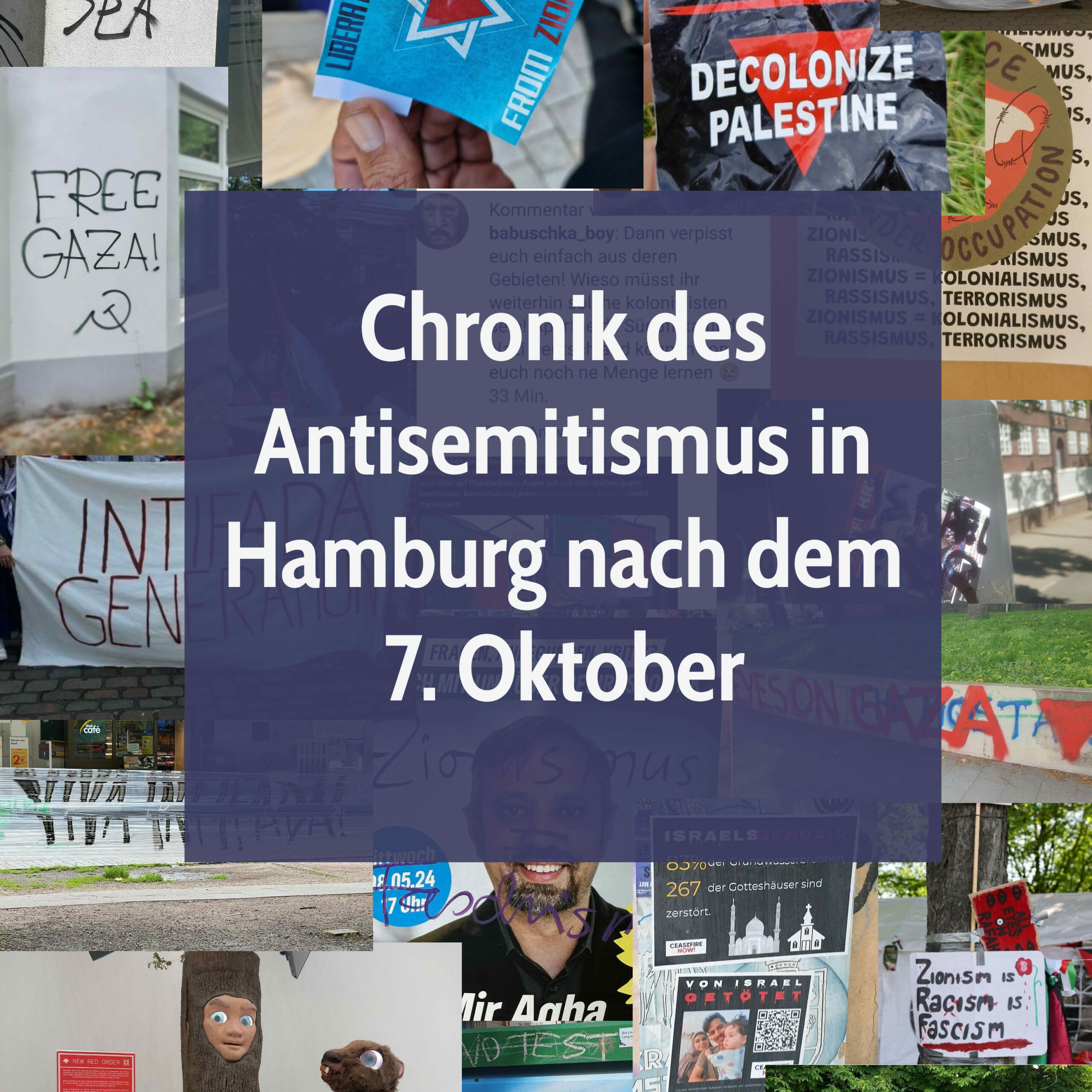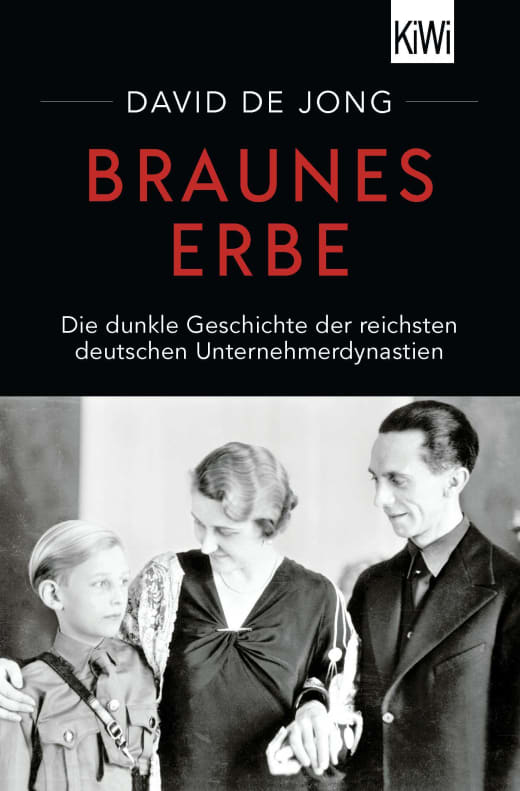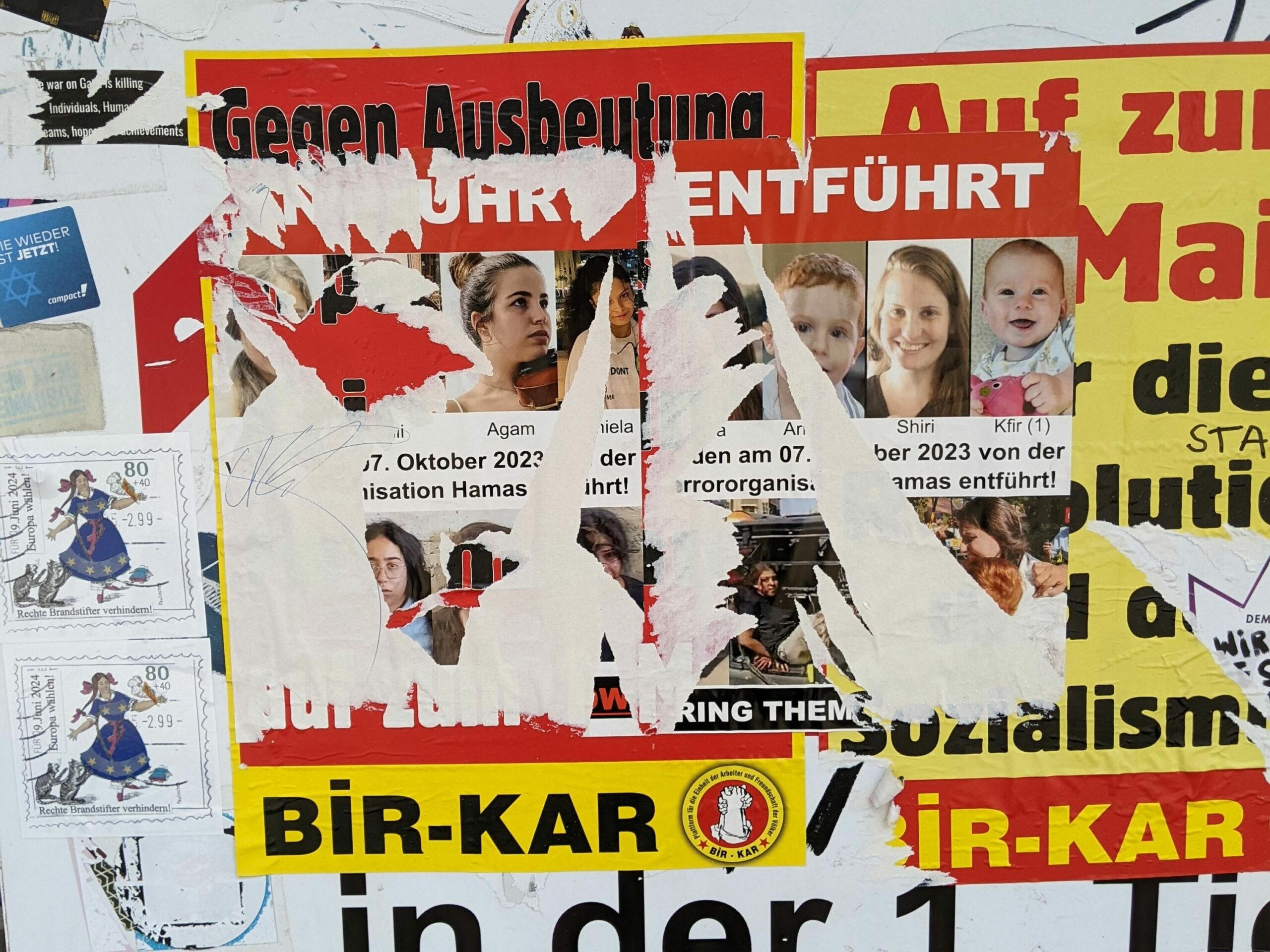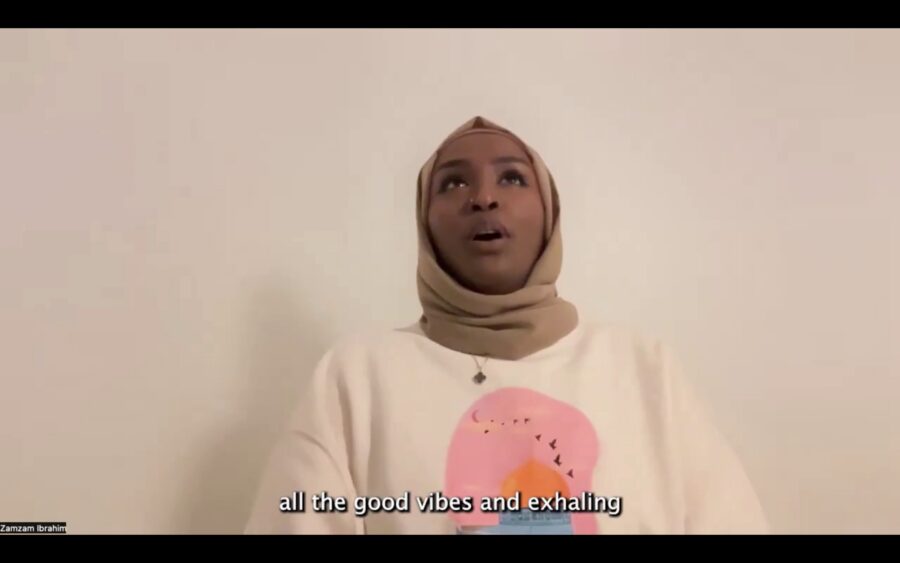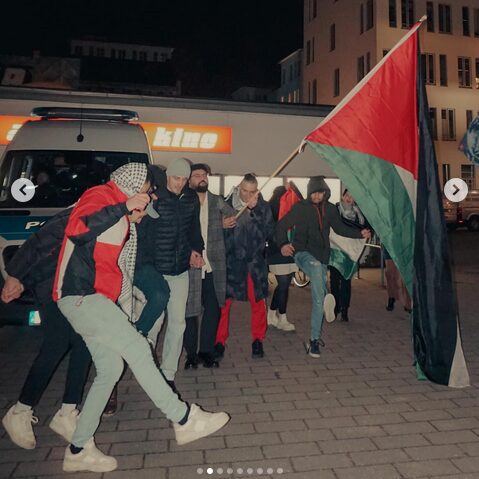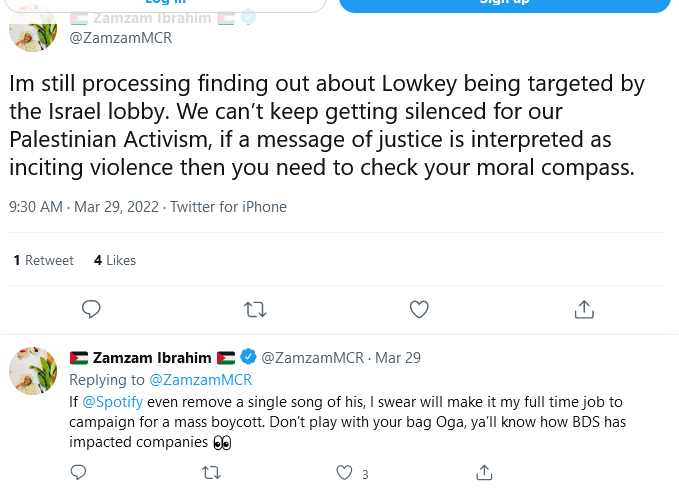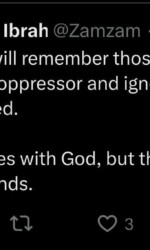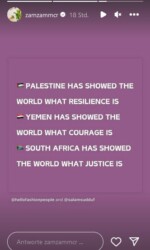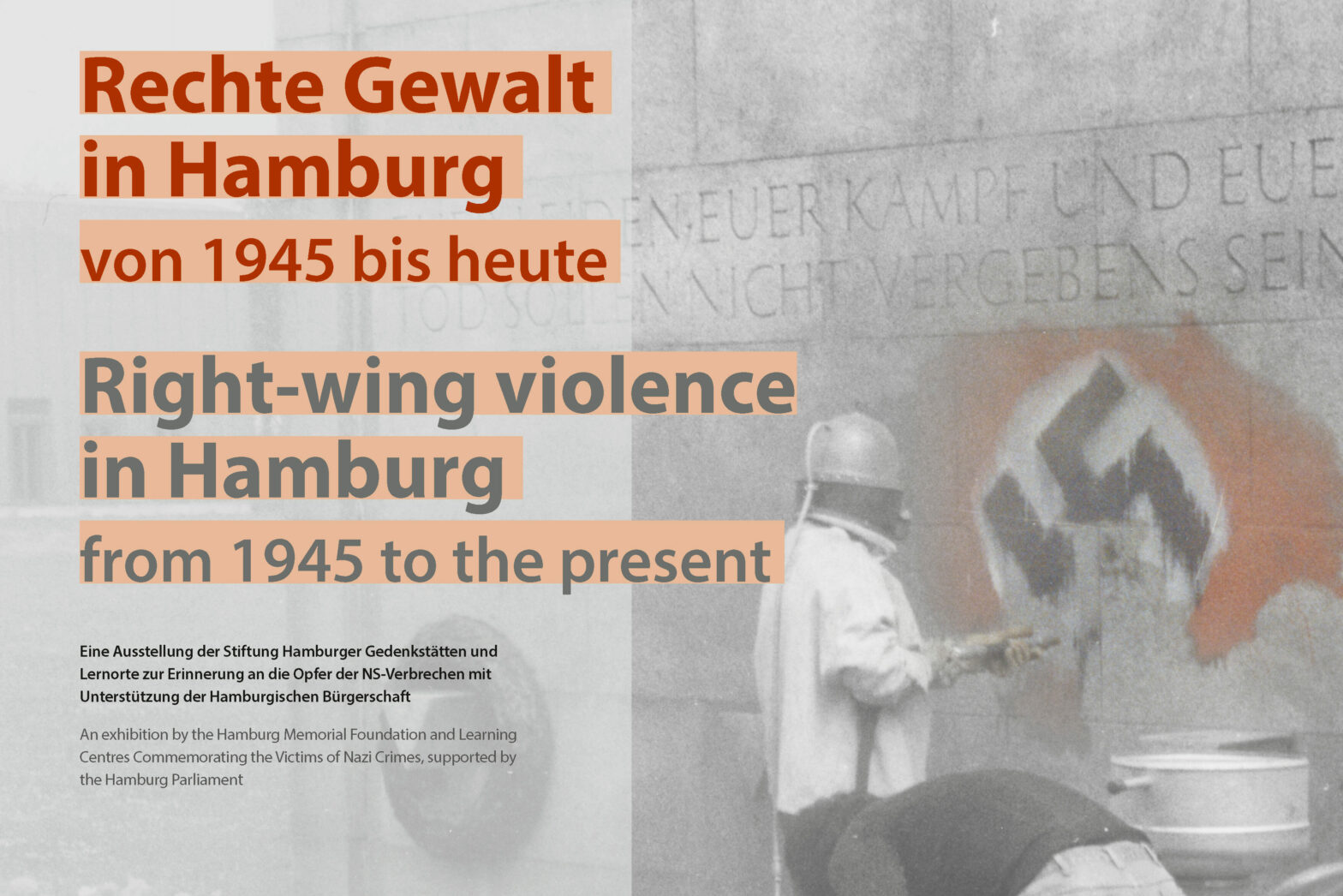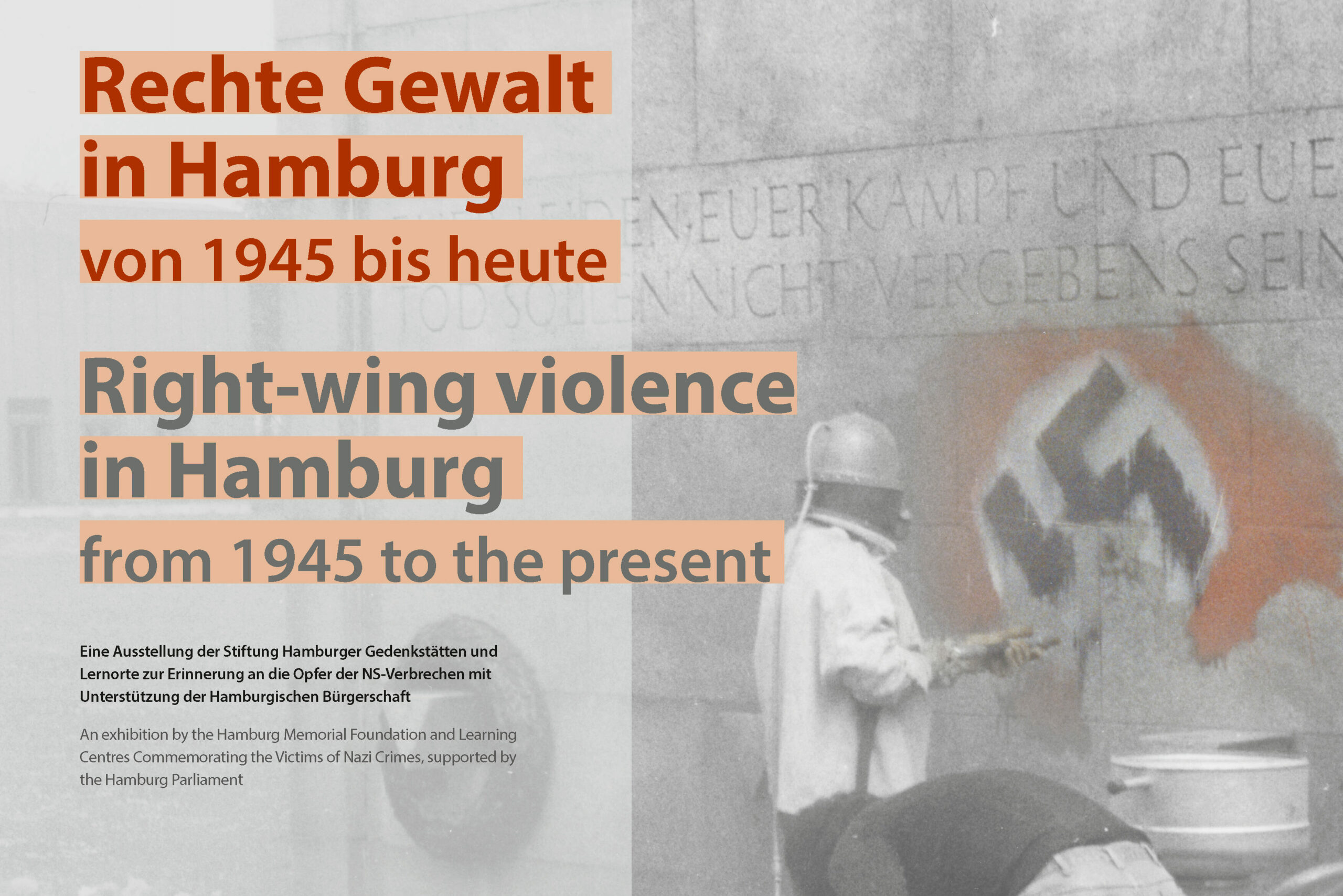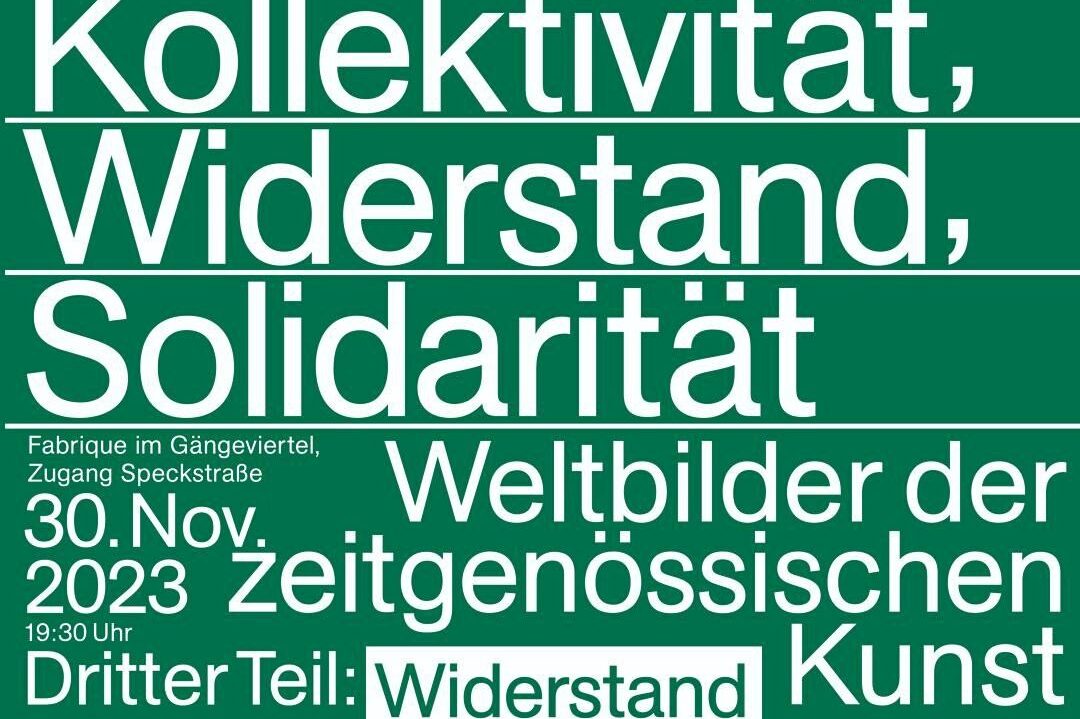Update: Geschichtsrevisionismus und nostalgischer Nationalismus bei der AfD Hamburg
***Update Februar 2025***
Die deutsche Geschichte ist für radikal rechte Parteien ein zentrales Agitationsfeld. Auch die Hamburger AfD verbreitet einerseits immer wieder klassisch revisionistische Thesen, die vor allem den Holocaust und die Kolonialgeschichte umdeuten. Vor allem aber vertritt sie einen nostalgischen Nationalismus, der für die eigene politische Agenda durch gezieltes Auswählen und Verschweigen Mythen über die deutsche Vergangenheit entwirft.
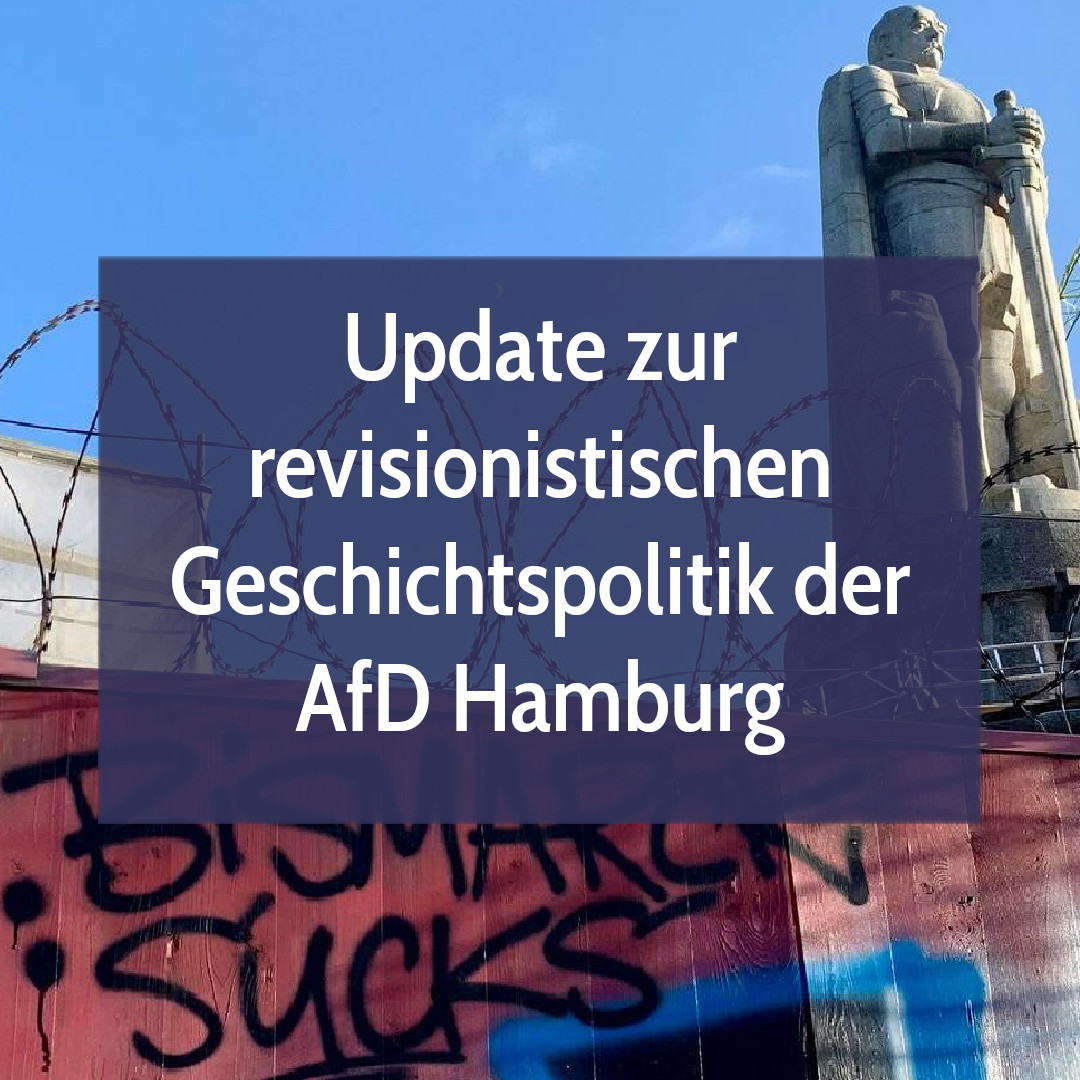
Dieses Update erscheint parallel auf AfD Watch Hamburg.
UPDATE Februar 2025
Wie wir im März letzten Jahres festgestellt haben, wird die geschichtspolitische Strategie der AfD Hamburg von einem nostalgischen Nationalismus bestimmt. Der offene Geschichtsrevisionismus, das Leugnen und Umdeuten historischer Verbrechen, ist dabei nicht im Vordergrund, kann aber jederzeit mit eingebaut werden. In den vergangenen Monaten ließ sich beobachten, dass vor allem die Kolonial- und Kaiserreichsapologetik von der AfD Hamburg vermehrt in politische Praxis übersetzt wird. Kritische Aufarbeitung der deutschen Geschichte versuchen sie als »Umerziehung« oder »Umschreiben der Geschichte« verächtlich zu machen. Drei Beispiele können das illustrieren:
Im April 2024 positionierte die AfD sich in der Bürgerschaft gegen den Erhalt der Forschungsstelle „Hamburgs (post-)koloniales Erbe“. Die LINKE hatte eine Debatte um Zukunft der auslaufenden Forschungsstelle beantragt. Unter anderem sprach sich Norbert Hackbusch klar für ihren Erhalt aus. In seinem Redebeitrag betitelt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende und kulturpolitische Sprecher der AfD in der Bürgerschaft, Dr. Alexander Wolf, den Inhaber der Professur an der Forschungsstelle, Prof. Dr. Jürgen Zimmerer, als »der als Wissenschaftler verbrämte Polit-Aktivist“. Er bezeichnet es als „Gewinn für unsere Stadt“, würde „diesem ‚Professor‘“ der „Geldhahn“ abgedreht. Über das allgemeine Projekt einer Dekolonisierung Hamburgs heißt es, es solle von „links-rot-grün die Geschichte umgeschrieben“ und die Menschen „umerzogen werden“.
Am 18.12.2024 beschlossen SPD und Grüne in der Bürgerschaft mit dem Doppelhaushalt für 2024 und 2025, die Forschungsstelle – wie von Beginn an vorgesehen – durch auslaufende Finanzierung faktisch einzustellen.
Auch im Sommer 2024 schoss die AfD gegen die Forschungsstelle „Hamburgs (post-)koloniales Erbe“. Deren App „Koloniale Orte“ kritisiert sie in einer kleinen Anfrage wegen der aus ihrer Perspektive großen Diskrepanz zwischen den registrierten Downloads und den Entwicklungskosten. Daraus leiteten sie die Forderung ab, es solle Schluss sein mit „Umerziehung und noch mehr Steuergeldverschwendung im Rahmen der ‚Dekolonisierung‘ Hamburgs!“
Im Oktober 2024 schließlich richtete sich die Schlussstrichforderung gegen das Museum am Rothenbaum für Kunst und Kulturen der Welt, kurz MARKK (ehemals »Völkerkundemuseum«). Mit einer kleinen Anfrage zielt die AfD wiederum auf die Kosten bzw. die Besucher:innenzahlen seit dem (noch laufenden) Umbau vom „Völkerkundemuseum“ zum MARKK. Wolf hatte sich schon 2017 kritisch zur Umbenennung geäußert und damals resümiert, das „Volk“ solle abgeschafft werden. Demagogisch stellte er damals das Staatsvolk, den fiktiven Souverän des Grundgesetzes, und ethnisch definierte Völker in eine Reihe. In einer Pressemitteilung zur Antwort des Senates auf die kleine Anfrage der AfD-Fraktion lässt Wolf sich am 18. Dezember 2024 wie folgt zitieren. Das »linksgrüne Erziehungsmuseum« sei gescheitert. Die Bürger:innen wollten »nicht bevormundet und beim Denken betreut werden«, vielmehr zeigten sie »der sogenannten kolonialistischen Schuld die kalte Schulter«. Die Forderung ergeht: »Wir wollen unser Völkerkundemuseum ohne linksgrünem (sic!) Tamtam zurück!“
Diese Anfragen und Pressemitteilungen zielen offenbar vor allem darauf ab, ein gesundes Volksempfinden herbeizureden, das sich nicht für eine »woke« Geschichtserzählung interessiere. Die angestrebte Normalisierung der deutschen Nationalgeschichte – also die guten 1000 minus die 12 »dunklen« Jahre – wird durch Angriffe auf Institutionen vermeintlicher linker »Umerziehung« vorangetrieben. Diesen Zusammenhang bringt eine Stellungnahme Wolfs aus dem Mai 2024 auf den Punkt. Wolf sprach mit Blick auf das städtische Erinnerungskonzept zum Umgang mit dem kolonialen Erbe, das im Mai 2024 vorgestellt wurde, von einem „linke[n] Kulturkampf“, der „Unsummen an Steuergeldern“ verschlinge. Vor allem: „Kein normaler Bürger legt Wert auf Straßenumbenennungen, bloß weil die Namen angeblich kolonial belastet seien. Kein normaler Bürger hat ein Problem mit Statuen von Christoph Kolumbus. Kein normaler Bürger hasst die eigene deutsche Geschichte so sehr wie linksgrüne Bilderstürmer.“
Die geschichtsrevisionistische Agitation der AfD Hamburg ist mustergültiges Beispiel der pathischen Projektion in der rechtsextremen Propaganda. Die AfD wirft sich in die Brust gegen eine angeblich umerziehende, bevormundende und geschichtsfälschende Erinnerungspolitik, während sie in Wahrheit natürlich selbst genau das verfolgt. Die hamburgische und die deutsche Geschichte überhaupt sollen, wenn’s nach ihnen ginge, nur noch glorreich, großartig und verdienstvoll gewesen sein. Was dazu nicht passt, soll beschwiegen werden. Und wer daran Kritik anmeldet, muss verblendet sein und also unterdrückt werden.
Redaktion Untiefen, Februar 2025
Das Verhältnis zur deutschen Vergangenheit ist die zentrale Eintrittskarte in den politischen Diskurs der BRD. Offene Holocaustleugnung oder ‑relativierung sind nicht nur strafbar, sondern auch politisch äußerst schädlich. Bei der populistischen, als Verteidigerin der Demokratie auftretenden AfD spielen sie daher auch in Hamburg nur eine untergeordnete Rolle. Dennoch wird immer wieder erkennbar, dass es sich hier um strategische Zurückhaltung handelt.
Offener Revisionismus
Bekannt sind etwa NS-Relativierungen des Hamburger AfD-Bundestagsabgeordneten Bernd Baumann, frühere revisionistische Kommentare des derzeitigen Hamburger AfD-Pressesprechers Robert Offermann und der Verdacht auf antisemitische Aussagen eines Mitarbeiters der Bürgerschaftsfraktion. Am meisten Aufsehen erregte wohl der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD in der Bürgerschaft, Alexander Wolf. 2017 wurde bekannt, dass er 1994 eine Sammlung von NS-Liedern unter dem Titel „Schlachtruf“ herausgab, in deren Vorbemerkungen er mit Blick auf die Kapitulation Nazi-Deutschlands im Zweiten Weltkrieg zu einem „entschlossenen ‚Nie wieder!’“ aufrief.
Alexander Wolf, geschichtspolitischer Scharfmacher
Überhaupt, Alexander Wolf: Er ist in der Bürgerschaftsfraktion der Mann für die provokanten historischen Thesen. So behauptete er etwa im März 2023 in der Bürgerschaft, die Nazis hätten sich „keineswegs als rechts, sondern bewusst als Sozialisten“ verstanden. Die DDR und den NS-Staat parallelisierte er als „Diktaturen“, um sogleich zu seinem eigentlichen Anliegen zu kommen, nämlich der Lüge, auch der heutige Kampf gegen Rechts sei wieder ähnlich eine ähnliche „Freiheitseinschränkung“ und „Ausgrenzung“.
„Vogelschiss“ als Programm: der nostalgische Nationalismus
Diese offenen Relativierungen sind aber die Ausnahme. Die wirkliche geschichtspolitische Strategie der Hamburger AfD besteht darin, die Gaulandsche Rede vom „Vogelschiss“ in die Praxis umzusetzen. In den Beiträgen der AfD-Abgeordneten findet sich kaum eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus oder mit der Kolonialgeschichte. Und wenn diese Themen berührt werden, dann geht es stets darum, für die radikal rechte Politik nostalgisch-nationalistische, positive Ankerpunkte in der deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts zu finden.
Historische Würdigung fordert die AfD etwa für folgende Gruppen: die Verschwörer um Claus Schenk Graf von Stauffenberg („Höhepunkt des deutschen Widerstands“), die Opfer der alliierten Bombardierung Hamburgs im Juli 1943 („Kriegsverbrechen“), die Aufständigen vom 17. Juni 1953 in der DDR („identitätsstiftendes Datum“) sowie für die an der Grenzen zwischen DDR und BRD Ermordeten und den Mauerbau 1961 („Schicksalsdatum der deutschen Nation“).
Und die im Jahr 2020 aufgekommenen Rufe nach einem Denkmal für die Leistungen der sogenannten türkischen „Gastarbeiter“ konterte Wolf im November 2021 mit der Forderung, stattdessen ein Denkmal für „Trümmerfrauen“ zu schaffen.
Das Kaiserreich soll rechtsradikale Herzen wärmen
Neben den deutschen Opfern alliierter Bomben und kommunistischer SED-Herrschaft sowie patriotischen konservativen Generälen steht vor allem das Deutsche Kaiserreich im Zentrum der AfD-Geschichtspolitik. Eine Folge des Podcasts „(Un-)Erhört!“ der Hamburger AfD-Fraktion vom Januar 2021 zum 150. Jahrestag der Reichsgründung 1871 illustriert das.
Zum eingangs gespielten „Heil dir im Siegerkranz“ spricht Wolf von einem „der glücklichsten Momente der deutschen Geschichte“. Heutige Politiker:innen würden sich jedoch der Erinnerung daran verweigern, sie hätten ein „gestörtes Verhältnis zur „eigenen Geschichte“. So hätte die „über tausendjährige Geschichte Deutschlands“ zwar „problematische Seiten“, doch sei sie eben auch „mehr“. Ab dort verschwindet der Nationalsozialismus aus dieser Erzählung und das heutige Deutschland wird schlicht in Kontinuität zum Kaiserreich gesetzt. Das ist eine ganz bewusste Konstruktion einer Tradition, die nur über Auslassung funktioniert. An die „positiven Momente der Geschichte“ soll erinnert werden, so Wolf weiter, „weil das unsere Identität prägt. Eine Nation lebt nicht nur von der Ratio und von der Verfassung, sondern auch von einem positiven Gemeinschaftsgefühl.“ Nur daraus könnten „Solidarität und Miteinander erwachsen.“
Gereinigt werden soll die deutsche Geschichte also nicht, indem der Holocaust geleugnet wird. Der „Schuldkult“-Vorwurf wird hier subtiler formuliert: Der bedingten Anerkennung der Verbrechen in den 12 Jahren NS-Herrschaft wird eine saubere Version der vermeintlich anderen 988 Jahre deutscher Geschichte und deutschen Glanzes entgegengestellt.

Mit Bismarck gegen die Wahrheit
Diese Strategie zeigt sich auch an der Position der AfD zur Debatte um das Otto von Bismarck-Denkmal auf St. Pauli. In einer Folge des besagten Podcasts vom Juli 2021 zeichnet Wolf den ersten Reichskanzler als eine positive Figur der deutschen Geschichte. Die geforderte Neu-Kontextualisierung des Denkmals sei selbst Geschichtsrevisionismus, schließlich würde Bismarck dabei „aus dem Blickwinkel eines Antifanten und einer Feministin“ gesehen. Die sogenannte Westafrika-Konferenz 1884/85 in Berlin, zu der Bismarck einlud und bei der die europäischen Großmächte den afrikanischen Kontinent als Kolonialbesitz unter sich aufteilten, verschweigt Wolf dabei nicht. Aber er stellt sie als rein friedensstiftende Maßnahme zur Sicherung der innereuropäischen Ordnung dar. Das funktioniert wiederum nur durch Ausblenden der Folgen für die kolonisierten Bevölkerungen außerhalb Europas. Aber mehr noch: Kolonialismus ist für Wolf „nicht per se von vornherein schlecht“. Denn es sei „viel Positives geleistet worden, Infrastruktur, Gesundheit etc.“ Es dürfe eben nicht „einseitig die negative Brille“ aufgesetzt werden, wie es bei der Black Lives Matter-Bewegung geschehen sei. So hält Wolf dann auch die gängige Forschungsposition, dass die Deutschen 1904/5 in Südwestfrika einen Völkermord begangen haben, für „absurd“, ja „Quatsch“. Man sieht: Obwohl nostalgischer Nationalismus die Kernstrategie der AfD Hamburg ausmacht, ist der Schritt zu offenem Revisionismus schnell gemacht.
Redaktion Untiefen, März 2024