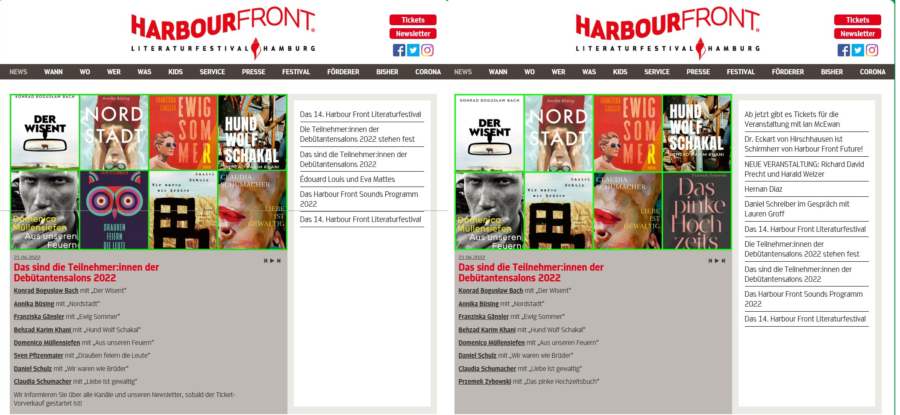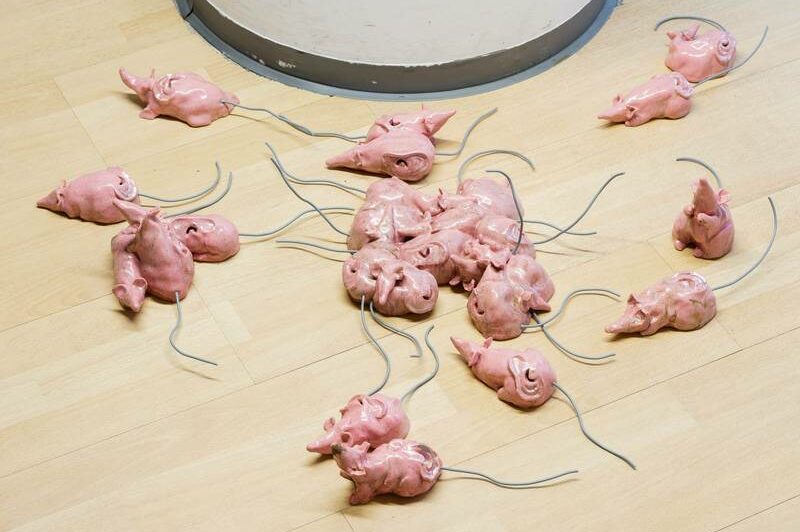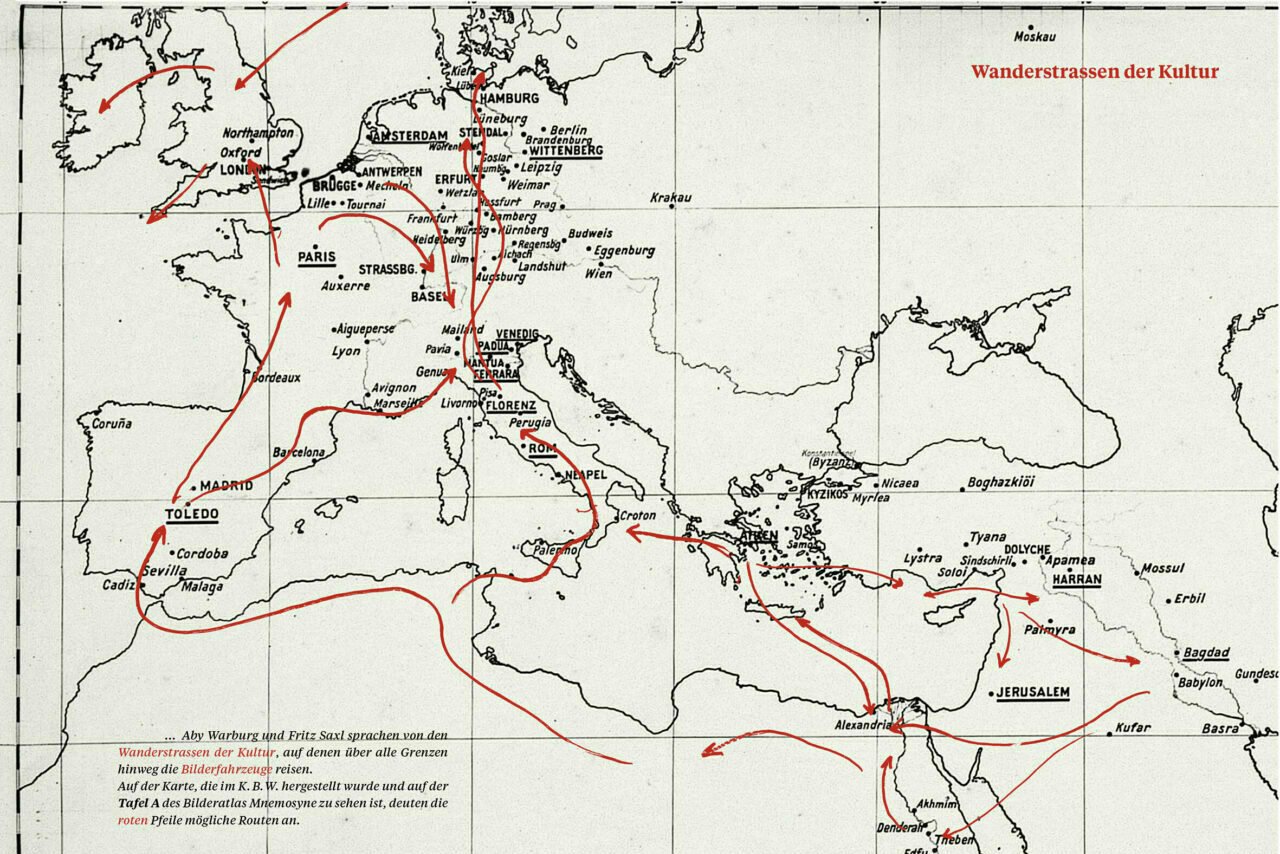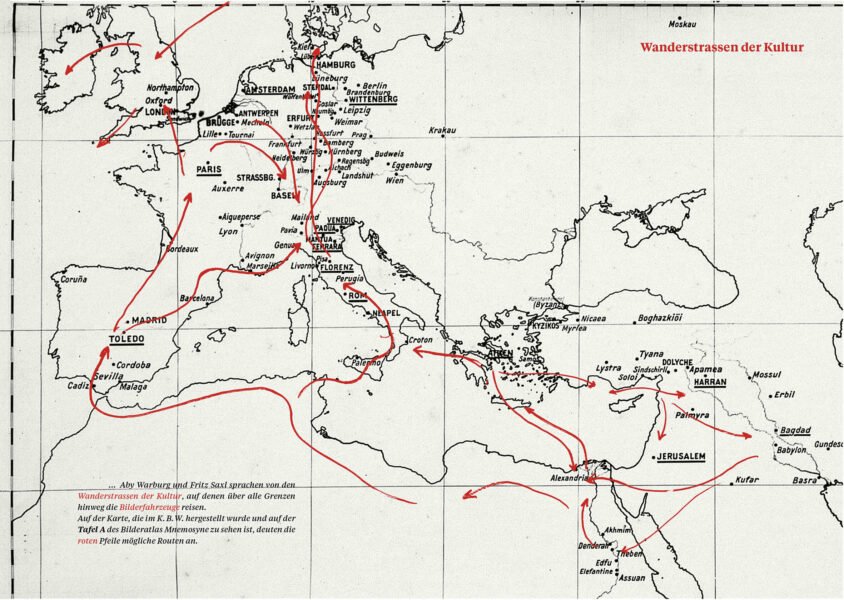45 Jahre Frauenhäuser in Hamburg
Im August 1977 eröffnete das erste der autonomen Hamburger Frauenhäuser. Seitdem sind sie unerlässlich für den Schutz vor Gewalt. Doch die Plätze sind rar und die Finanzierung von politischem Wohlwollen abhängig. Aus einer feministischen Praxis sind prekäre Institutionen geworden. Anlässlich des Internationen Tags gegen Gewalt an Frauen fragt unsere Autorin eine Mitarbeiterin: Wie geht es den Hamburger Frauenhäusern heute?

Für die Frauenbewegung der 1970er-Jahre war die Organisierung gegen Gewalt gegen Frauen zentraler Bestandteil der politischen Arbeit. Gewalt in der Beziehung galt zuvor lange als »Einzelschicksal«. Die Frauen der zweiten Welle des Feminismus thematisierten diese männliche Gewalt durch Selbsterfahrungsgruppen und Organisierung als strukturelles Problem von Frauen im Patriarchat. Auch in Hamburg organisierten sich im Jahr 1976 Frauen, um gegen geschlechtsspezifische Gewalt zu kämpfen. Sie gründeten den Verein Frauen helfen Frauen e.V. und erschufen innerhalb eines Jahres das erste autonome Hamburger Frauenhaus. Das Selbstverständnis damals: Das Frauenhaus ist ein Teil der Frauenbewegung und soll unabhängig sein – alle Frauen entscheiden gemeinsam, was passieren soll.
Da die Finanzierung noch nicht staatlich abgesichert war, mussten die Frauen zunächst alles selbst machen – renovieren, Möbel organisieren, Spenden sammeln, das Haus schützen. So erinnert sich auch eine Zeitzeugin in der filmischen Dokumentation »Juli 76 – Das Private ist Politisch« an die ersten Jahre des Hauses: »Selbstorganisation. Selbstbestimmung. Das ist auch eine Utopie gewesen.« Das Frauenhaus selbst war feministische Praxis.
Selbstorganisation und Professionalisierung
Die Selbstorganisation stieß jedoch auch an zeitliche, finanzielle und emotionale Grenzen, wie die ehemalige Redakteurin der Hamburger Frauenzeitung Dr. Andrea Lassalle in einer Chronik der Hamburger Frauenhäuser im digitalen deutschen Frauenarchiv nachzeichnet. Innerhalb der Frauenbewegung wurden daher Debatten um die Organisierung und Struktur der Frauenhäuser geführt, die eng verzahnt waren mit den damaligen politischen und theoretischen Analysen um (unbezahlte) Sorgearbeit, Hierarchiefreiheit und Unabhängigkeit.
Mittlerweile wurden Frauenhäuser durch bezahlte Mitarbeiterinnen aus der Sozialen Arbeit professionalisiert. Dadurch entstand ein Widerspruch zwischen Selbstwirksamkeit und Professionalität, der im Alltag der Mitarbeiterinnen und Bewohnerinnen bis heute eine Rolle spielt. Im Gespräch mit Untiefen berichtet eine Mitarbeiterin eines Frauenhauses in der Metropolregion Hamburg, die Professionalisierung sei grundsätzlich der anspruchsvollen Arbeit mit Frauen und Kindern aus akuten Gewaltsituationen angemessen. In vielen autonomen Frauenhäusern übernehmen allerdings auch die Bewohnerinnen selbst noch Teile der täglichen Arbeit, beispielsweise die nächtliche Aufnahme.
In Hamburg ist dafür seit 2016 die 24/7, die zentrale Notaufnahme für die Hamburger Frauenhäuser, zuständig. Die Mitarbeiterinnen nehmen die akut betroffenen Frauen auf und vermitteln sie dann an Häuser weiter. Dies entlaste die Bewohnerinnen von den nächtlichen und wöchentlichen Notdiensten, so die Mitarbeiterin. Gleichwohl könne es den Bewohnerinnen auch Stärke zurückgeben, einen Teil beizutragen und andere Frauen zu unterstützen. Allerdings übernehmen die Bewohnerinnen diese Aufgaben nicht in erster Linie aufgrund dieser ermächtigenden Wirkung, sondern schlichtweg, weil das Personal fehle.

Foto: Dirtsc Lizenz: CC BY-SA 3.0
Die befürchtete Hierarchie zwischen professionalisierten und ehrenamtlich arbeitenden Frauen in den Häusern konnte trotz basisdemokratischer Struktur nicht vermieden werden. Da die Frauenhäuser mittlerweile öffentlich finanziert und tariflich gebunden sind, werden auch die Anforderungen an die Qualifikationen der Mitarbeiterinnen höher – und schließen damit viele Frauen, auch ehemalige Bewohnerinnen, aus. Doch gerade diese Frauen bringen oft sowohl eigene Erfahrung mit partnerschaftlicher Gewalt und dem Leben im Frauenhaus mit als auch Sprachkenntnisse, die dem Leben im Haus zuträglich sein könnten. Die geringe Anerkennung ausländischer Abschlüsse in der Sozialen Arbeit und die strukturelle Ungleichheit im Bildungssystem in Deutschland tragen dazu bei, dass die Mitarbeit im Frauenhaus nicht allen gleichermaßen zugänglich ist – und die Teams ihrem Anspruch an Diversität nicht immer gerecht werden können.
Feministische Debatten in der Frauenhauspraxis
Mit dem Auftreten antirassistischer Diskurse an den Universitäten und in der feministischen Szene entbrannten auch innerhalb der Frauenhäuser Debatten über Rassismus und Diskriminierung, im Zuge derer mit Quotierungen in den Teams und bei den Aufnahmen experimentiert wurde. Weniger diskutiert wurde hingegen jahrelang das hot topic der aktuellen feministischen Debatten: Was ist eine Frau? Bis vor wenigen Jahren, so eine Mitarbeiterin, war die Diskussion darum, was Geschlecht eigentlich ist, in Frauenhäuser nicht anschlussfähig. Dies ändert sich jedoch derzeit, insbesondere durch jüngere Kolleginnen.
Die etwa in der Debatte um das »Selbstbestimmungsgesetz« geäußerte Befürchtung einiger Feministinnen, Frauenschutzräume könnten unterlaufen werden, wenn Geschlecht an eine empfundene Identität statt an körperliche Merkmale geknüpft ist, erscheint angesichts des von der Mitarbeiterin beschriebenen Frauenhausalltags weniger eine praktische als vielmehr eine theoretische Frage zu sein: »Die Frau kommt – die kann mir auch irgendwas erzählen, wer sie ist – sie muss mir auch nicht ihren Perso zeigen. So arbeiten wir nicht. Die Frau erzählt, und wenn sie von häuslicher Gewalt betroffen ist, dann wird sie aufgenommen.« Der rechtliche Personenstand spielt in der Praxis keine Rolle. Jede Aufnahme ist außerdem eine Einzelfallentscheidung und berücksichtigt die Erfahrungen der Bewohnerinnen. Und: nicht jede sei für diese Art des Zusammenwohnens geeignet, auch das spielt bei den Aufnahmegesprächen eine Rolle.
In Hamburg wurde zudem vor zwei Jahren das 6. Frauenhaus gegründet, das sich explizit als Schutzraum für trans Frauen positioniert und die seit Jahren gängige Praxis untermauert. Viel wichtiger als die theoretische Definition von Geschlecht erscheint jedoch die Frage, ob in den Häusern überhaupt genug Plätze vorhanden sind. Zu Beginn der Pandemie fehlten in Hamburg rund 200 Frauenhausplätze.
Zu wenige Plätze, zu wenig Geld, zu wenig Personal
Obwohl aktuelle innerfeministische Debatten durchaus zum Thema werden, nimmt das alltägliche Rotieren, auch aufgrund fehlenden Personals, in den Häusern einen Großteil der Zeit ein. Die Art und Weise der öffentlichen Finanzierung unterscheidet sich je nach Bundesland und Gemeinde. Während in Hamburg, Schleswig-Holstein und Berlin die autonomen Frauenhäuser durch eine Pauschale pro Platz im Haus finanziert werden, ist die Finanzierung in anderen Bundesländern direkt an die betroffene Frau gekoppelt. Da sie in einigen Ländern über das Sozialhilfegesetz abgewickelt wird, sind Frauen mit eigenem Einkommen, Studentinnen und Frauen mit unsicherem Aufenthaltsstatus davon ausgeschlossen. Diese Frauen werden, wenn möglich, in Ländern mit Pauschalfinanzierung untergebracht, da sie die Plätze sonst selbst zahlen müssten – vorausgesetzt, Aufenthaltsbestimmungen oder der Job lassen einen Umzug zu und es sind freie Plätze vorhanden. Die Zentrale Informationsstelle der autonomen Frauenhäusern (ZIF) fordert dementsprechend eine bundesweite einzelfallunabhängige Finanzierung der Frauenhäuser.
Doch auch die pauschale Finanzierung bringt Schwierigkeiten mit sich. Der Erhalt sowie die Ausweitung der Plätze sind vom Wohlwollen der jeweiligen Landesregierungen abhängig. Um einer drohenden Schließung zu entgehen, wurden im Jahr 2006 das 1. und das 3. Autonome Frauenhaus zusammengelegt. Der CDU-geführte Senat hatte Kürzungen beschlossen, da die Versorgungslage in Hamburg besser sei als in anderen Großstädten.

Männergewalt und Femizide
Laut behördlicher Auskünfte wurden in Hamburg im laufenden Jahr insgesamt 16 Frauen getötet, sechs davon von ihrem (Ex-)Partner, bei den zehn anderen ist die Einordnung unklar. Die Zahl der Femizide, also der Tötung von Frauen und Mädchen aufgrund ihres Geschlechts, ist in jedem Fall alarmierend. Allerdings ist Femizid im deutschen Recht kein eigener Tatbestand, er wird unter Partnerschaftsgewalt subsumiert. Studien und genaue Fallzahlen zu Femiziden fehlen entsprechend im deutschsprachigen Raum weitgehend. Die frauenpolitische Sprecherin der Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft Cansu Özdemir kritisierte daher jüngst den Senat für seine Weigerung, eine Untersuchung zu Femiziden in Hamburg als »nötige wissenschaftliche Basis für ein zielgerichtetes und wirkungsvolles Präventionskonzept« in Auftrag zu geben.
Bewohnerinnen und ehemaligen Bewohnerinnen von Frauenhäusern steht die Gefahr, Opfer eines Femizids zu werden, besonders deutlich vor Augen. 2018 wurde die 42-Jährige Juliet H. von ihrem Expartner ermordet. Nachdem sie in einem Hamburger Frauenhaus Schutz gesucht hatte, zog sie mit ihren Kindern in eine eigene Wohnung, wo sie von ihrem Exmann getötet wurde. Doch nicht nur für die Bewohnerinnen sind solche Fälle alarmierend. Es setzt auch die Mitarbeiterinnen enorm unter Druck, die mit knappen Ressourcen und staatlichen Hürden kämpfen, um den Frauen Schutz und eine Perspektive zu bieten.
Väterrechte stehen über dem Schutz von Frauen und ihren Kindern. Die Veränderungen im Familienrecht der letzten Jahre machen die Situation von Frauen aus Gewaltbeziehungen gefährlicher. Die Zeit unmittelbar nach der Trennung vom gewalttätigen Partner birgt das höchste Risiko, Opfer eines (versuchten) Femizids zu werden. Umso wichtiger ist dann ein unkomplizierter Zugang zu einem Frauenhaus. Dieser Schutz wird allerdings durch das familienrechtlich angestrebte Wechselmodell untergraben.
Das von der jetzigen Bundesregierung in den Mittelpunkt von Sorge- und Umgangsrecht gestellte Wechselmodell soll eigentlich zu einer gleichberechtigten Aufteilung der Erziehung und Verantwortung für gemeinsame Kinder führen. Es bedarf jedoch einer Kommunikation auf Augenhöhe, um die nötigen Absprachen für dieses Arrangement zu treffen. Übt der Vater Gewalt über die Mutter aus, ist diese Augenhöhe offensichtlich nicht gegeben. Aus der Praxis berichtet die Mitarbeiterin, dass dem Vater durch das Umgangsrecht in diesen Fällen ermöglicht wird, weiterhin Kontrolle und Gewalt auszuüben. Das Wechselmodell steht deshalb bei Feministinnen und Initiativen für Alleinerziehende Mütter in der Kritik.
Gerichte ordnen sogar bei Müttern, die im Frauenhaus leben, das Wechselmodell an. Die Mitarbeiterin des Frauenhauses beschreibt: »Wenn die [Frau] Kinder hat, geht’s sofort los mit Kontakt zu Jugendamt, Kontakt zu Anwälten, dann wird irgendwer versuchen sofort das Aufenthaltsbestimmungsrecht zu beantragen, es werden Sofortumgänge in die Wege geleitet mit den gewalttätigen Vätern – und das ist krass.«
Die Gerichte gingen ohne weiteres davon aus, dass die Gewalt durch den Auszug der Mutter aufgehört habe und also bei Verfahren zum Sorge- und Umgangsrecht nicht berücksichtigt zu werden brauche. Die Mütter müssten daher irgendwie Vorkehrungen treffen, um dem gewalttätigen Mann die Kinder zu übergeben, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Durch Personalmangel ist es den Mitarbeiterinnen in den Frauenhäusern oft nicht möglich, Frauen zu diesen Übergaben zu begleiten.
Nach 45 Jahren sind autonome Frauenhäuser also zwar anerkannte Institutionen zum Schutz von Frauen vor Gewalt. Aber ihre Existenz bleibt prekär und die Situation der Frauen selbst wird komplexer. Die Mitarbeiterin und ihre Kolleginnen erwarten vom Senat und der Bundesregierung eine Erhöhung der Anzahl der Plätze und eine bundesweite pauschale Finanzierung. Im Sorge- und Umgangsrecht müsse das Personal geschult werden, um den Gewaltschutz konsequenter berücksichtigen. Nicht die Frauen sollten im Haus Schutz suchen und dann um ihre Kinder kämpfen müssen, sondern die Männer sollten beweisen, dass sie nicht gefährlich sind, schließt die Mitarbeiterin.
Die Autorin schrieb für Untiefen bereits über die Herbertstraße als Symbol männlicher Herrschaft.