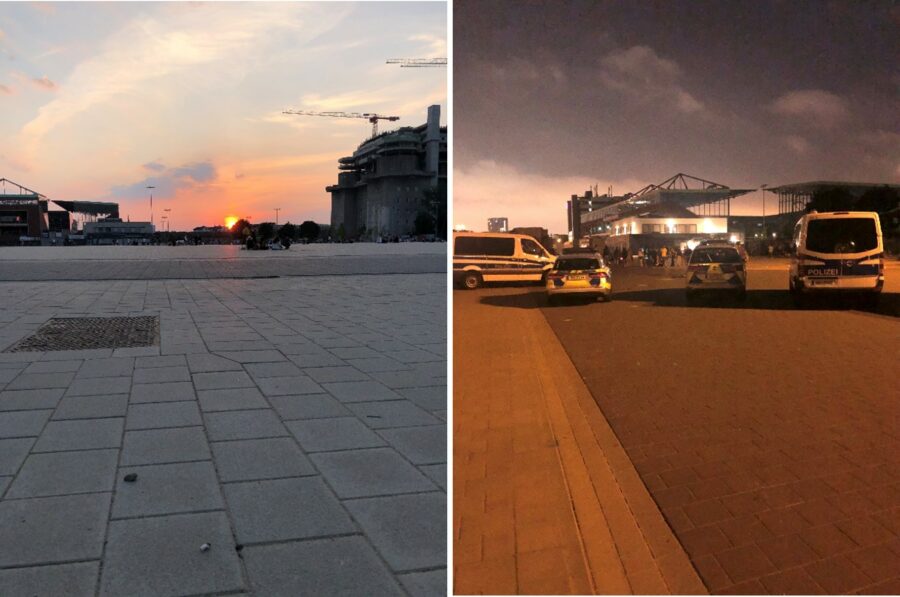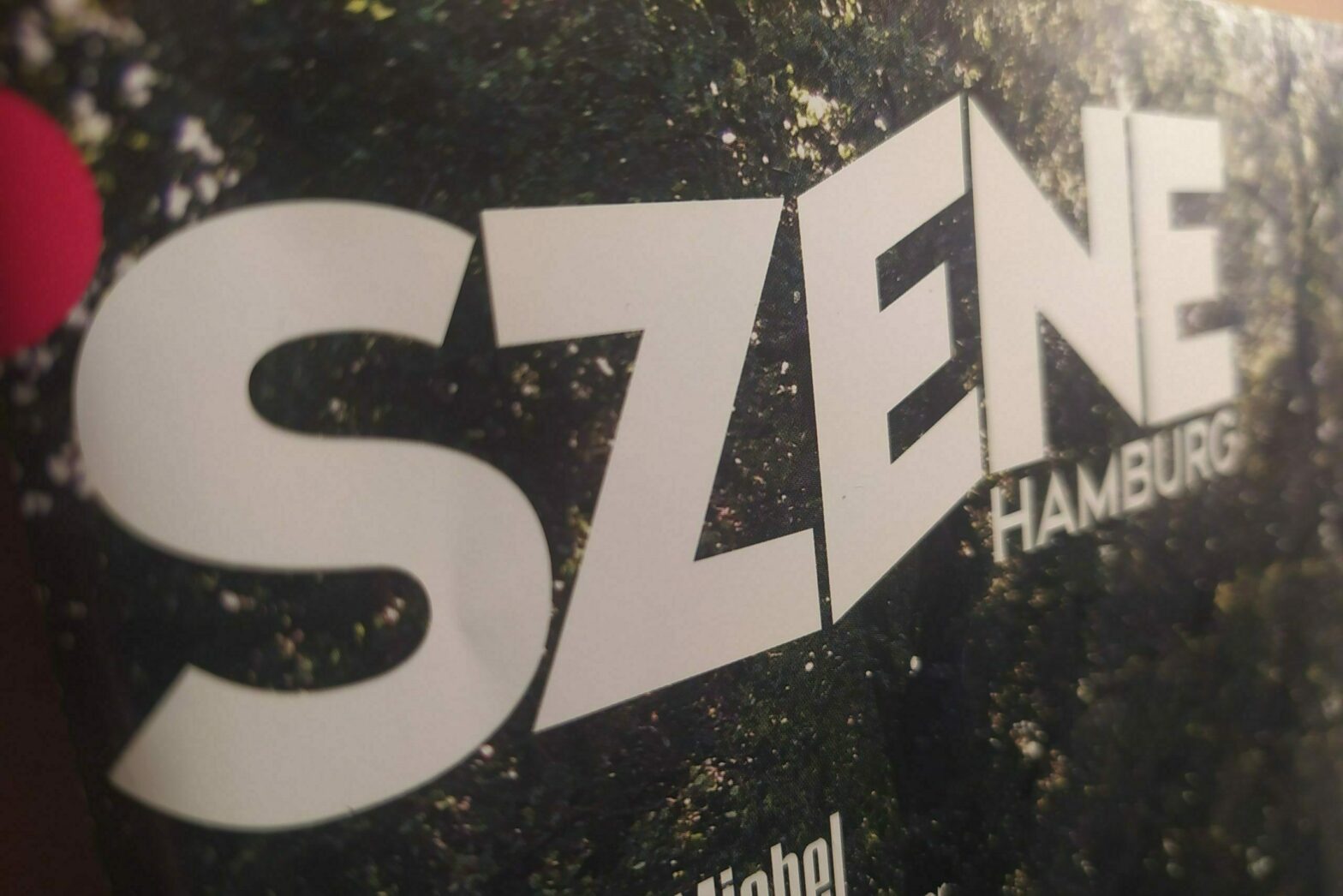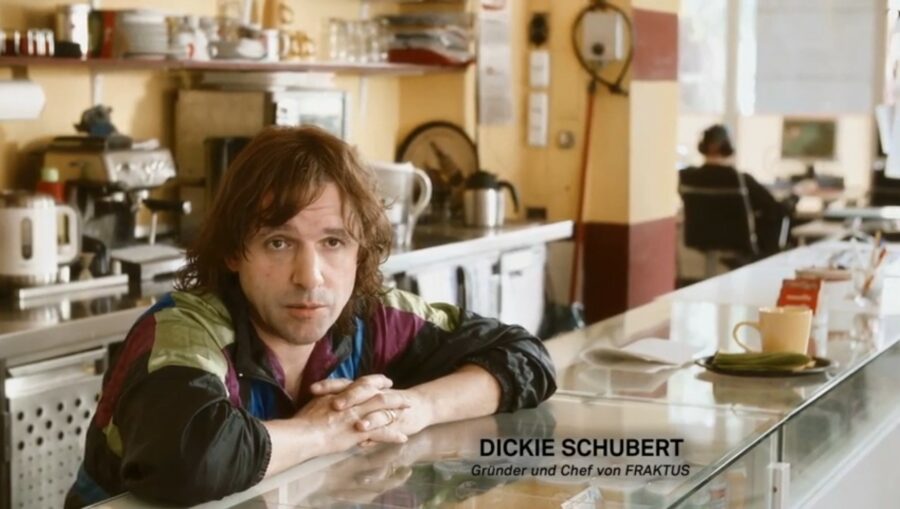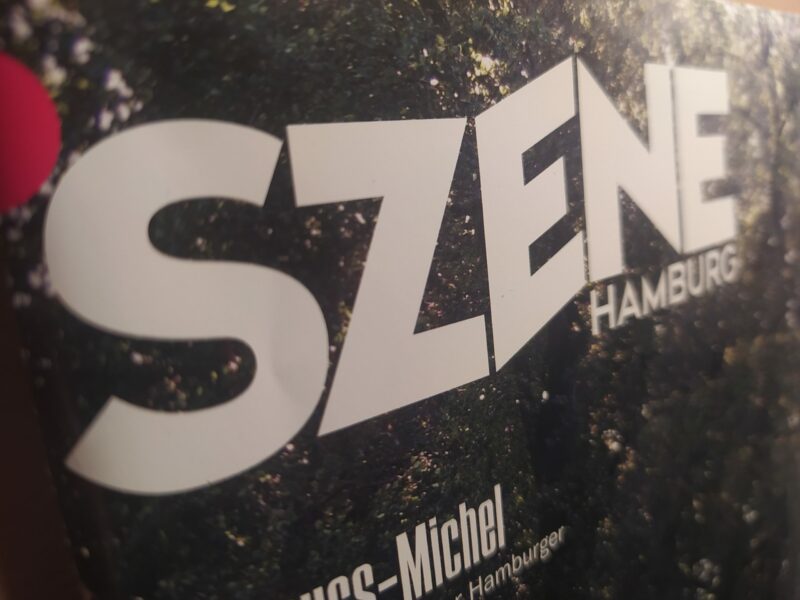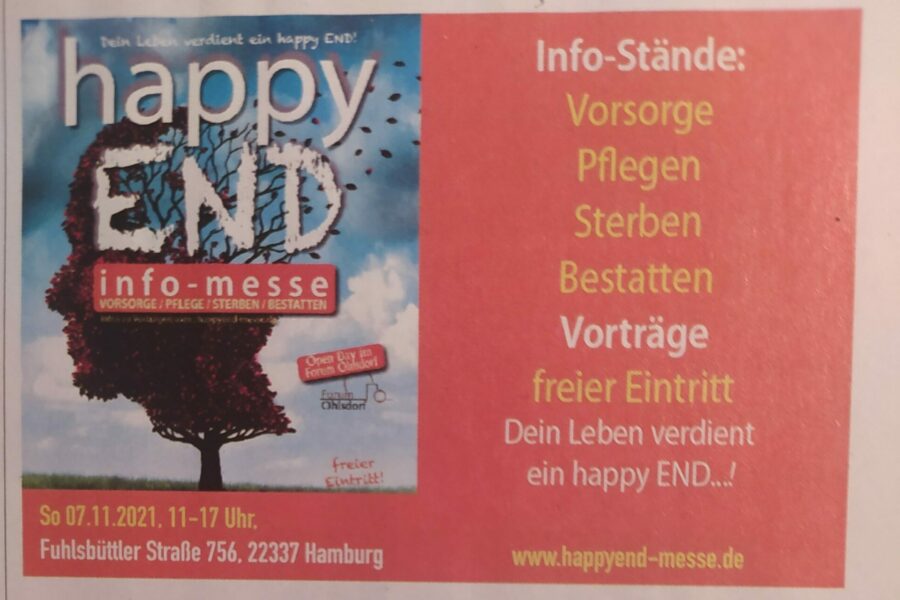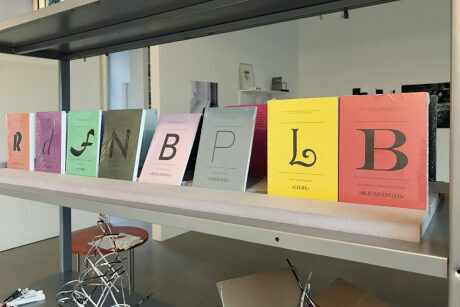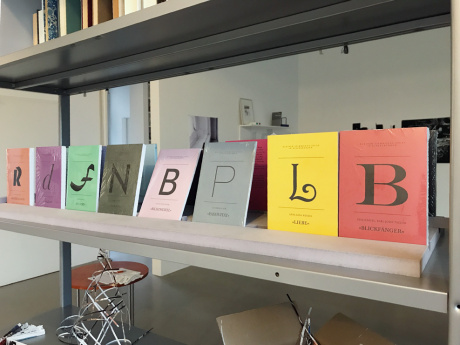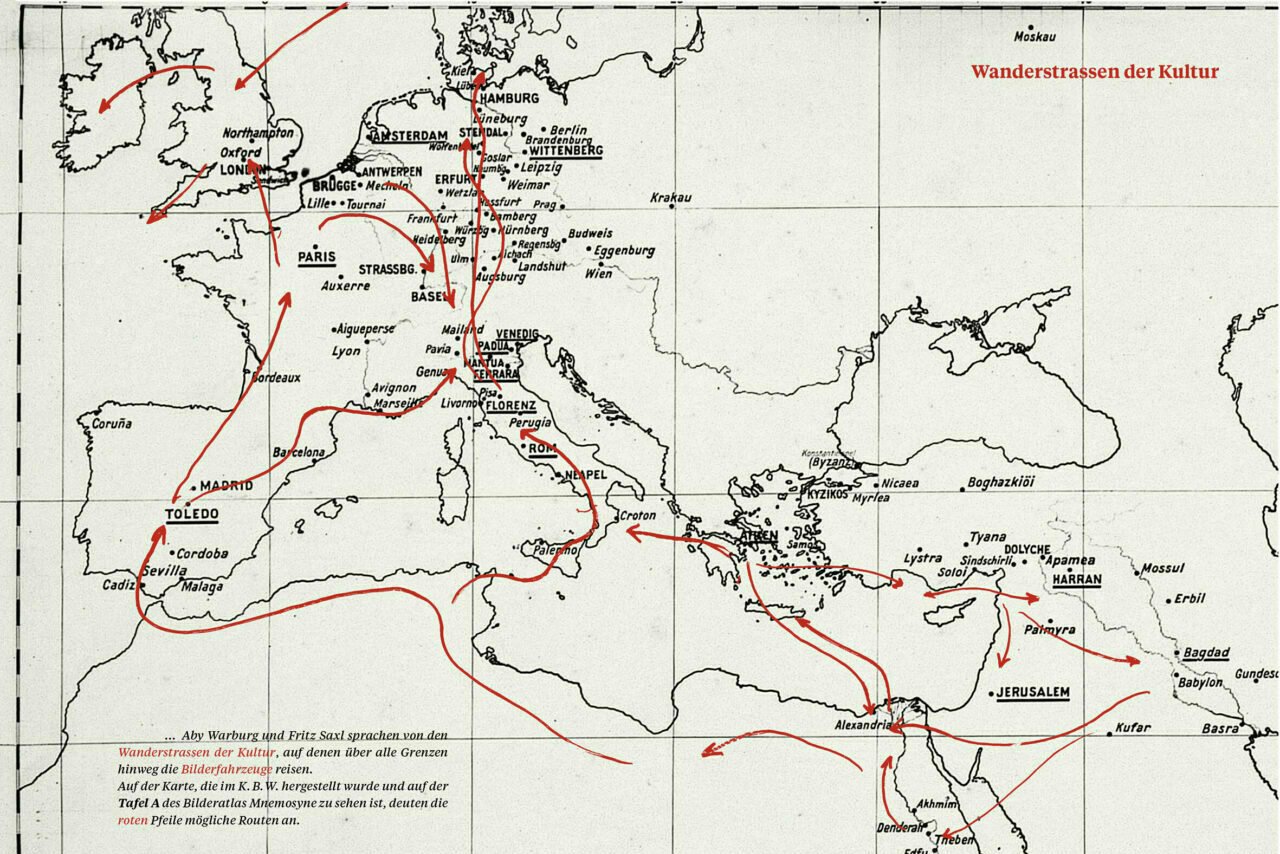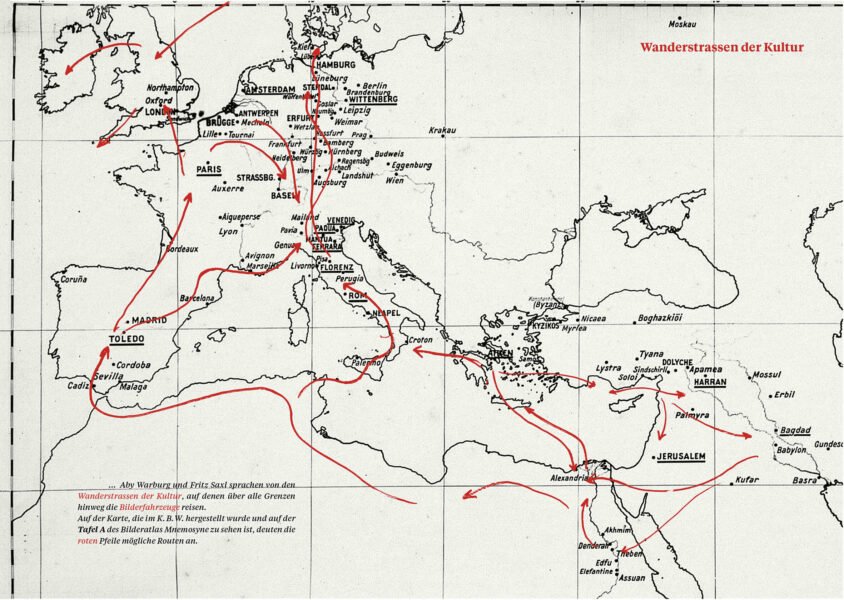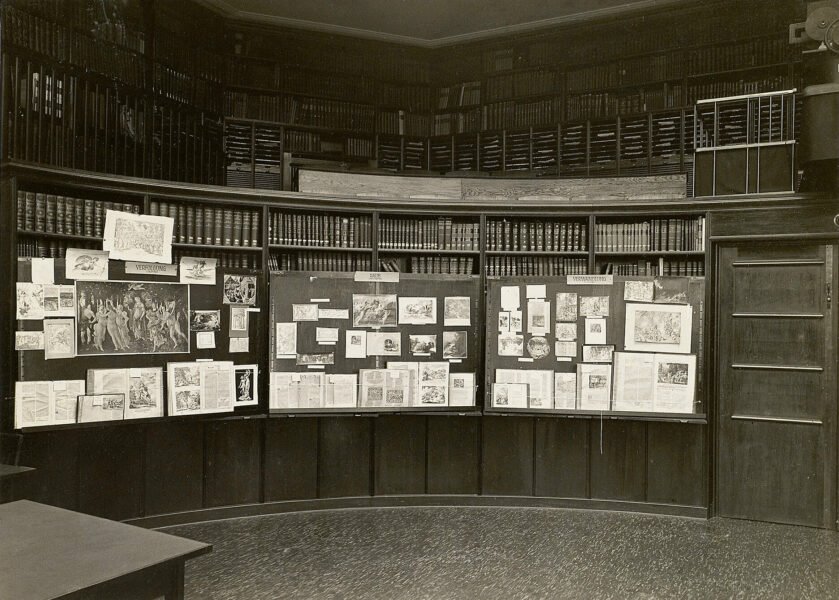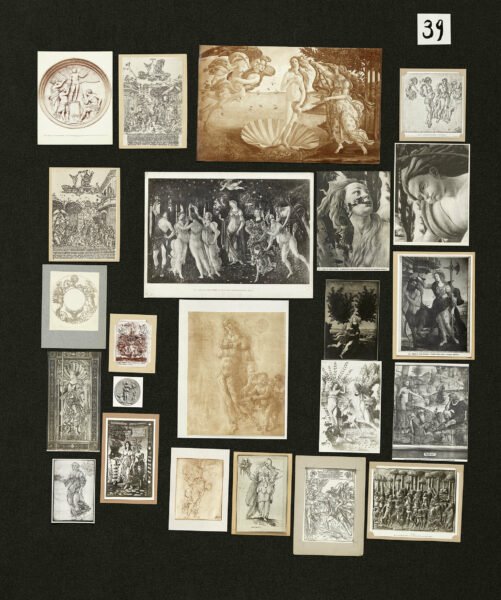Im Nebel des Krieges
Vor gut zwei Wochen begann die Invasion der russischen Armee in die Ukraine. Die Sach- und Informationslage ist unübersichtlich und verändert sich ständig, doch jeder Tag bringt neue Schreckensmeldungen. Millionen Menschen fliehen nach Westen. Wie reagiert Hamburgs Linke?

»Go East!«, prangt groß auf dem Titel der Märzausgabe von konkret, darunter: »Die Nato-Aggression gegen Russland«. Ausgeliefert wurde das Heft am selben Tag, an dem Russland seinen Einmarsch in die Ukraine begann. Auf Facebook und der konkret-Website veröffentlichte die Redaktion sogleich eine kurze Stellungnahme, die den Eiertanz zu vollführen versucht, zähneknirschend die Unangemessenheit dieses Titels einzugestehen und sich trotzdem nicht vom Inhalt zu distanzieren. »So war das mit dem Kreml nicht abgesprochen« gewesen, verlautbart man beschämt-ironisch, um dann die eigene Fehlanalyse – denn wie sicher musste man sich sein, dass Putin keinen Krieg beginnt, um so einen Titel zu veröffentlichen?! – als kritische Äquidistanz darzustellen: konkret hege weder Verständnis für den Angriffskrieg und »Moskaus machtpolitische Ambitionen« noch sei man bereit, ein »Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Weltordnung des Westens« abzulegen. Am 7. März veröffentlichte konkret dann noch eine Podcastfolge, die wegen des Kriegs, mit dem man nicht gerechnet hatte, neu aufgenommen wurde (»um uns nicht komplett zu blamieren«). Darin versuchen die Herausgeberin Friederike Gremliza und der auf die strategisch-geopolitische Vogelperspektive spezialisierte Autor Jörg Kronauer, der in konkret lange das »Erfolgsmodell Putin« pries, zu erläutern, warum sie nun derart falsch lagen. Kronauers kleinlaut-uneinsichtige Erklärung: Der Überfall auf die Ukraine sei ein ihm noch unerklärlicher vollständiger Bruch mit der zuvor »völlig rational kalkulierten« und im Vergleich zur westlichen Politik »viel enger am Völkerrecht« orientierten russischen Außenpolitik. Keine Rede davon, dass sich spätestens im Lichte des jetzigen Kriegs auch derlei apologetische Haltungen gegenüber der putinistischen Außenpolitik der letzten Jahre blamieren.
Die alte Friedensbewegung in der Krise
Das Hamburger Magazin befindet sich mit dieser Einschätzung in fragwürdiger Gesellschaft. Die Nachricht von der russischen Invasion fuhr insbesondere der traditionell antiimperialistischen und oftmals antiamerikanischen Friedensbewegung massiv in die Parade. Die Hamburger DKP etwa hatte einen Krieg im Gegensatz zu konkret zwar offenbar für realistisch gehalten, dabei aber in völliger Verkennung der Fakten die russische Kriegspropaganda reproduziert. In der Mitte Februar erschienenen Ausgabe 1/2022 der Zeitung des Landesverbands, Hamburger Utsichten, verkündet der Landesvorsitzende Michael Götze: »Es ist unglaublich, wie ein Krieg um die Ukraine geradezu herbeigeredet und ‑geschrieben wird. Tausende ukrainische Soldaten marschierten zuerst an die in Minsk vereinbarte Grenze zu den Provinzen Donezk und Lugansk. Die Ukraine wird von den Nato-Staaten mit Waffen vollgepumpt. Aber der Russe ist schuld. Man wartet geradezu auf die Meldung; ›Seit 5 Uhr früh wird zurückgeschossen.‹ « Vom unsäglichen NS-Vergleich ganz abgesehen: Ein Eingeständnis, dass man mit dieser Warnung vor einer Nato-Invasion in Russland völlig falsch lag, sucht man auf der Hamburger DKP-Seite vergeblich. Stattdessen findet sich dort eine Erklärung des Parteivorstands, die den von Russland seit 2014 unterstützten Bürgerkrieg in der Ostukraine als einen vom »nationalistische[n] Regime der Ukraine« geführten »achtjährige[n] Krieg gegen den Donbass« bezeichnet.
Noch eklatanter war die Fehleinschätzung der Volksinitiative gegen Rüstungsexporte. Am 21. Februar, drei Tage vor der russischen Invasion, veröffentlichte sie einen Aufruf zu einer »Friedenskundgebung« am 26. Februar mit dem Motto »Keine Waffenexporte in die Ukraine«. In dem Aufruf heißt es: »Das Säbelrasseln, die Feindbildpropaganda und Panikmache um einen vermeintlichen Einmarsch Russlands in die Ukraine müssen aufhören. Jetzt müssen Dialog und die ernsthafte Diskussion über Sicherheitsgarantien für alle Seiten auf der Tagesordnung stehen. Mit dem Abzug der Manövertruppen aus der Grenznähe zur Ukraine hat die russische Regierung erneut die Hand dazu ausgestreckt.« Geteilt wurde dieser Aufruf unter anderem vom Hamburger Forum und vom frisch aus der Linken ausgetretenen Bürgerschaftsabgeordneten und Querfrontler Mehmet Yildiz. Die Kundgebung fand, unter völlig neuen Bedingungen, am 26. Februar statt – doch von Einsicht oder gar einem Eingeständnis der eklatanten Fehleinschätzung über Russlands zur Versöhnung ›ausgestreckte Hand‹ war den Redner:innen (unter ihnen Yildiz und der notorische Norman Paech) nichts anzumerken.
Unstimmigkeiten in der Linkspartei
Ähnlich wie konkret und DKP kompromittierte sich die Bundestagsabgeordnete und Landessprecherin der Hamburger Linken Żaklin Nastić mit einseitigen Schuldzuweisungen an den Westen kurz vor Kriegsbeginn. In einer Pressemitteilung vom 20. Februar zur Münchner Sicherheitskonferenz beklagte sie, dass »der Westen« nicht »auf russische Forderungen nach Sicherheitsgarantien« eingegangen sei und dass »Russland […] als Aggressor und die Ukraine als Opfer dargestellt« worden seien. Nachdem sich das vermeintliche Zerrbild Russlands als Aggressor in bittere Realität verwandelt hatte, verschob sich Nastićs Argumentation in Richtung ›it takes two to tango‹: Zusammen mit Sahra Wagenknecht und einigen anderen Abgeordneten der Partei Die Linke verfasste sie eine Erklärung zum Angriff Russlands auf die Ukraine, in welcher der »von den USA in den letzten Jahren betriebenen Politik« eine »maßgebliche Mitverantwortung« für den jetzigen Krieg zugeschrieben wird.
Der Landesverband und die Bürgerschaftsfraktion der Linken hingegen haben deutlich gemacht, dass sie einem solchen äquidistanten Antiimperialismus äußerst kritisch gegenüberstehen. Die Partei rief zur Teilnahme an der von Fridays for Future initiierten Friedensdemonstration in der Hamburger Innenstadt am 3. März auf und mobilisierte selbst zu einer anschließenden Kundgebung vor dem russischen Konsulat – unter anderem mit dem unmissverständlichen Hashtag #fckptn. Mediale Aufmerksamkeit erlangte die Partei vor allem mit ihrer Forderung, die in Hamburger Werften liegenden Luxusjachten russischer Oligarchen festzusetzen: Man müsse den »Oligarchen in die Suppe spucken, damit sie sich gegen Putin wenden«, zitiert die Mopo den ehemaligen Bundestagsabgeordneten der Linken Fabio de Masi. Gleichzeitig wendete sich Die Linke Hamburg aber auch gegen den geplanten 100-Milliarden-Euro-Sonderetat für die Bundeswehr und forderte, Maßnahmen zur Kompensation der massiven Preissteigerungen bei Gas, Strom und Kraftstoffen zu ergreifen, von denen vor allem die Armen betroffen seien.
Die radikale Linke zwischen Solidarität und Kritik

Auch große Teile der postautonomen und Bewegungslinken in Hamburg ergreifen Partei gegen den russischen Einmarsch in die Ukraine. Die Interventionistische Linke war mit einem Redebeitrag auf der Kundgebung der Linkspartei vor dem russischen Konsulat vertreten. Die Gruppe Projekt Revolutionäre Perspektive (PRP) verfasste einen Aufruf zu einem antimilitaristischen Block auf der Demo am Samstag – gegen den Krieg und gegen die deutschen Aufrüstungsabsichten –, dem sich mehrere Gruppen anschlossen. Die auf den Transpis sichtbaren Forderungen aus dem Reservoir der linken Antikriegsbewegung (von »Wir wollen eure Kriege nicht« bis »Der Hauptfeind steht im eigenen Land«) wirkten eher hilflos und der konkreten Situation nicht wirklich angemessen. Doch immerhin artikulierte dieser Block den aktuell dringend notwendigen Einspruch gegen Aufrüstung und Nationalismus. Im blau-gelben Fahnenmeer ging der ziemlich in der Mitte der Demo gelegene Block allerdings weitgehend unter. Ein symptomatisches Bild für die aktuelle Situation der Linken: Jedweder Versuch der Differenzierung wird laut übertönt. Das gilt nicht nur für die Kritik an der deutschen Aufrüstung und am aggressiven ukrainischen Nationalismus, sondern auch für die Warnung vor dem Einfluss rechtsextremer Gruppierungen in der ukrainischen Armee und Gesellschaft (der sich nicht zuletzt in der staatlichen Ehrung des Faschistenführers Stepan Bandera ausdrückt), für die Anprangerung der rassistischen und antiziganistischen Doppelmoral, die sich in der aktuellen Flüchtlingspolitik zeigt, und für Kritik an der deutschen Öffentlichkeit, die von all dem nichts wissen will und der deutschen Militarisierung sekundiert.1 Etwa wenn in einem MDR-Beitrag vom 6. März die Entscheidung zum Dienst in der Bundeswehr als patriotischer Akt bejubelt wird.

In dieser schwierigen Lage bieten die 14 Punkte, mit denen der Twitter-Account Antifa Info Hamburg am 2. März eine mögliche antifaschistische Antwort auf die aktuelle Situation skizzierte, eine gute erste Orientierung. Einer der Punkte lautet: »Widersprüche aushalten«. Denn durch die blau-gelbe Brille, die nahezu alle (vermeintlichen) Friedensfreund:innen gerade aufhaben, sind Nuancen kaum zu erkennen – im Gegenteil, taucht sie doch auch so manchen braunen Gegenstand in leuchtende Farben. Zu den Widersprüchen, auf die eine radikale Linke in dieser Situation aufmerksam machen muss, gehört auch, dass sich unter den Parteigängern beider Konfliktseiten Rechtsextreme und Nazis befinden: Das Hamburger Bündnis gegen Rechts macht vor allem auf den Putinismus der Hamburger AfD aufmerksam – die Bürgerschaftsabgeordnete Olga Petersen etwa war im September 2021 als »Wahlbeobachterin« in Russland, wo sie die »Transparenz« der Duma-Wahl lobte. Antifa Info Hamburg wiederum weist auf die Symboliken hin, an denen man die auch in der hiesigen Ukraine-Solidarität mitmischenden rechtsextremen Kräfte wie den Rechten Sektor und Asow erkennt. Darauf, dass sich in der Ukraine aber auch sich als links verstehende Gruppen für einen bewaffneten Kampf gegen die russische Armee entscheiden, verweist der Account @anarchyinHH. Andere autonome Gruppen wie die Antifa Norderelbe teilen Aufrufe, die anarchistische Initiative Operation Solidarity zu unterstützen, die »networks of mutual aid within Ukraine« aufbauen möchte.
Praktische Solidarität
Derlei Netzwerke praktischer Hilfe haben sich derweil auch schon in Hamburg gegründet. Aus der Black Community Hamburgs – maßgeblich waren hier die Aktivistin Asmara und die SPD-Bezirksabgeordnete Irene Appiah – wurden Busse organisiert, mit denen an der ukrainisch-polnischen Grenze rassistisch diskriminierte Schwarze Flüchtende nach Hamburg gebracht wurden.2Auch über den Hauptbahnhof kamen Afrorukrainer:innen nach Hamburg. Ein auf Facebook zu sehendes (leider akustisch sehr schlecht zu verstehendes) Video von Twi Radio Germany vom 7. März etwa zeigt ein Interview mit einem siebzehnjährigen Schüler und Nachwuchsfußballer aus Nigeria, der aus Kiew geflohen ist und von rassistischer Diskriminierung während der Flucht berichtet. Es zirkulierten Aufrufe zu Geld- und Sachspenden (Powerbanks, Benzinkanister, Taschenwärmer) für den Einsatz an der ukrainischen Grenze und natürlich Aufrufe, Flüchtende vor Ort mit Sachspenden und Unterbringung zu unterstützen. Der Berliner Verein quarteera e.V., in dem sich russischsprachige LGBT* in Deutschland organisieren, ruft zur Unterstützung queerer Geflüchteter auf und vermittelt Unterkünfte – auch in Hamburg. Über Telegramgruppen, etwa die »autonom unter antinationalem Kontext gegründet[e]« Gruppe Ukraine Support Hamburg und Umgebung werden Informationen weitergegeben und wird effizient und solidarisch Hilfe organisiert. Ähnliche Messengergruppen für einzelne Viertel bilden sich gerade nahezu täglich. Die Hilfe, die hier organisiert wird, ist wie schon 2015 angesichts der katastrophal schlecht vorbereiteten öffentlichen Anlaufstellen dringend nötig.
Vor allem über russischsprachige Telegram-Gruppen hat sich schon länger ein ehrenamtliches Unterstützungsnetzwerk am Hauptbahnhof gebildet. Seit Anfang März werden dort ankommende Flüchtende in Empfang genommen und bei ihrer Ankunft unterstützt. Da sie seit dem 6. März auch durch den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) unterstützt werden, gibt es am Hauptbahnhof gerade häufig mehr freiwillige Helfer:innen als nötig. Ob das aber weiterhin so bleibt, ist fraglich – die Erfahrungen von 2015 haben gezeigt, dass derlei Ausbrüche von Hilfsbereitschaft in Hamburg meist nur von kurzer Dauer sind.
Redaktion Untiefen, März 2022
Die Mitglieder der Redaktion hoffen, dass ihnen der Spagat zwischen Vaterlandsverrat und praktischer Solidarität gelingt, ohne dass sie sich schwere Zerrungen zuziehen.
- 1Etwa wenn in einem MDR-Beitrag vom 6. März die Entscheidung zum Dienst in der Bundeswehr als patriotischer Akt bejubelt wird.
- 2Auch über den Hauptbahnhof kamen Afrorukrainer:innen nach Hamburg. Ein auf Facebook zu sehendes (leider akustisch sehr schlecht zu verstehendes) Video von Twi Radio Germany vom 7. März etwa zeigt ein Interview mit einem siebzehnjährigen Schüler und Nachwuchsfußballer aus Nigeria, der aus Kiew geflohen ist und von rassistischer Diskriminierung während der Flucht berichtet.