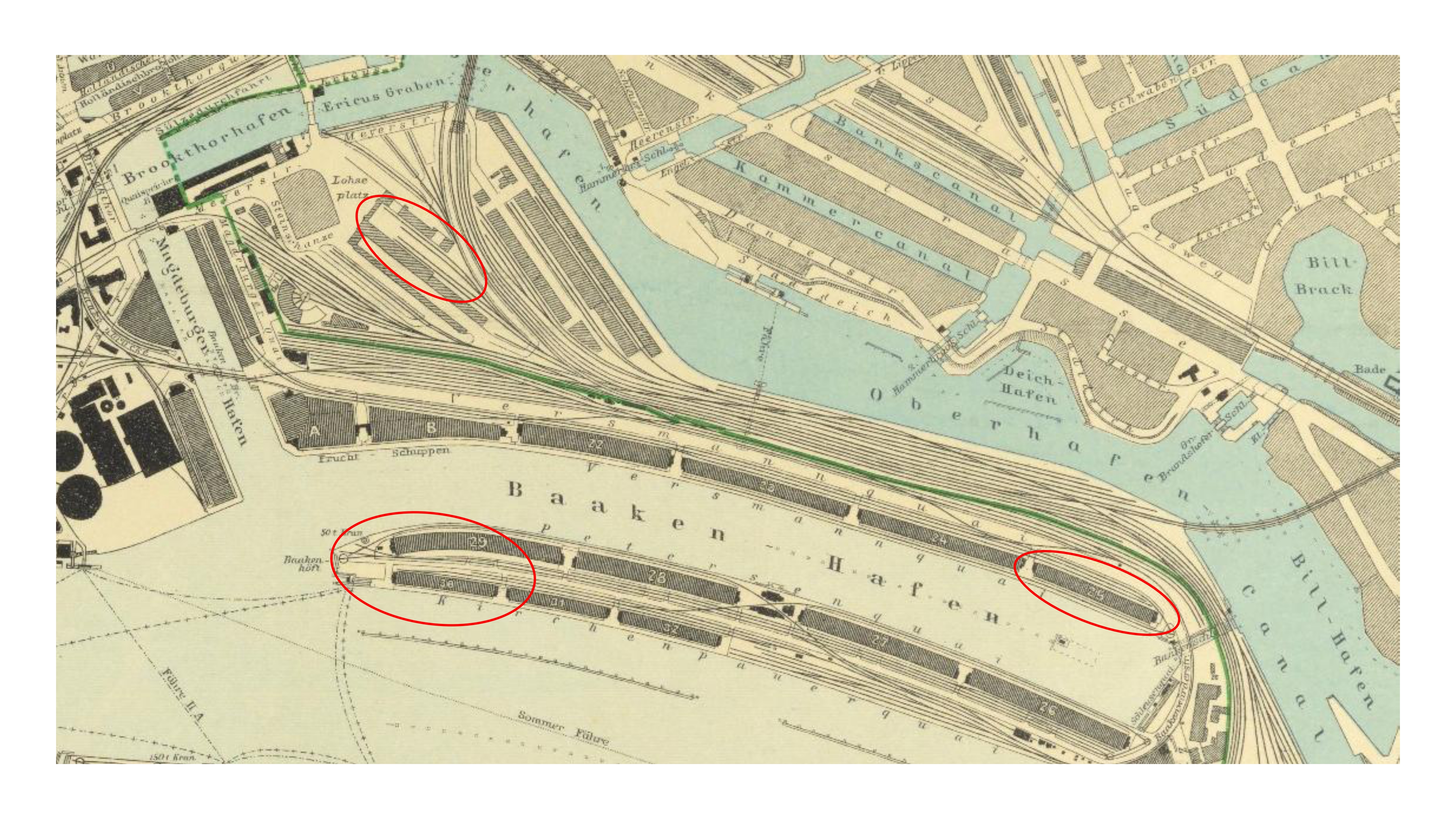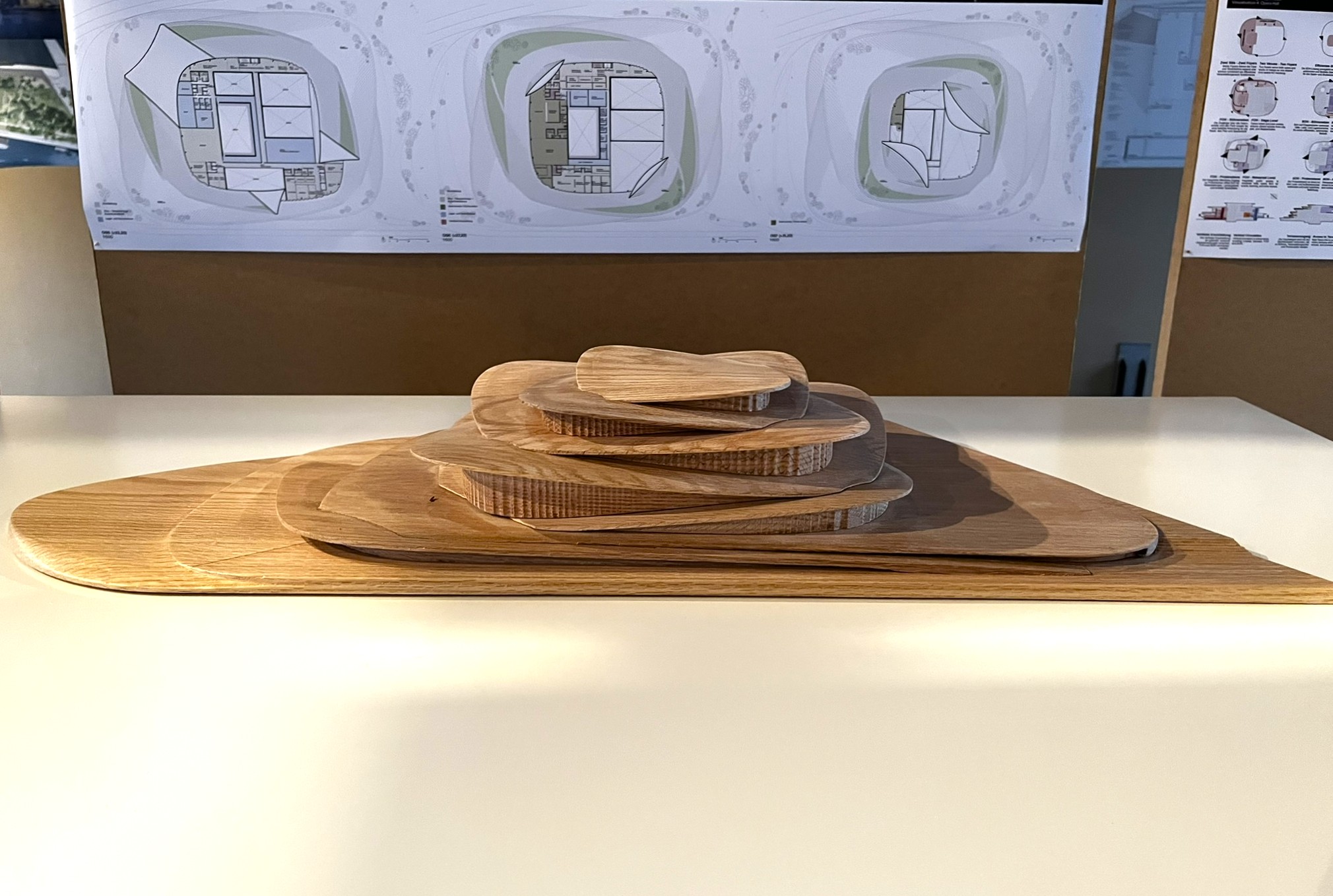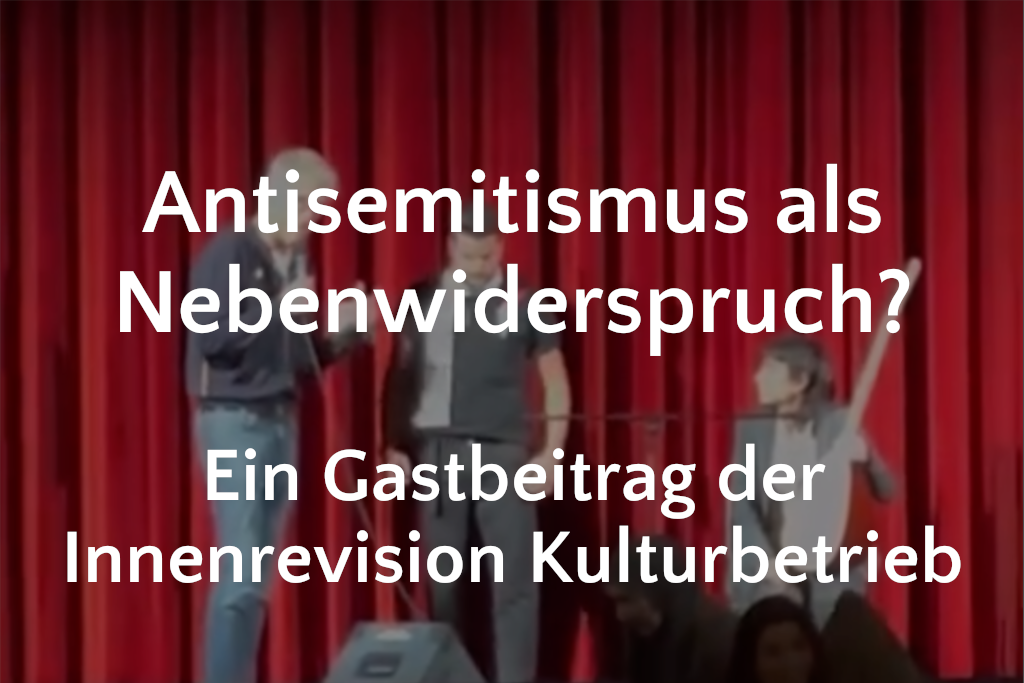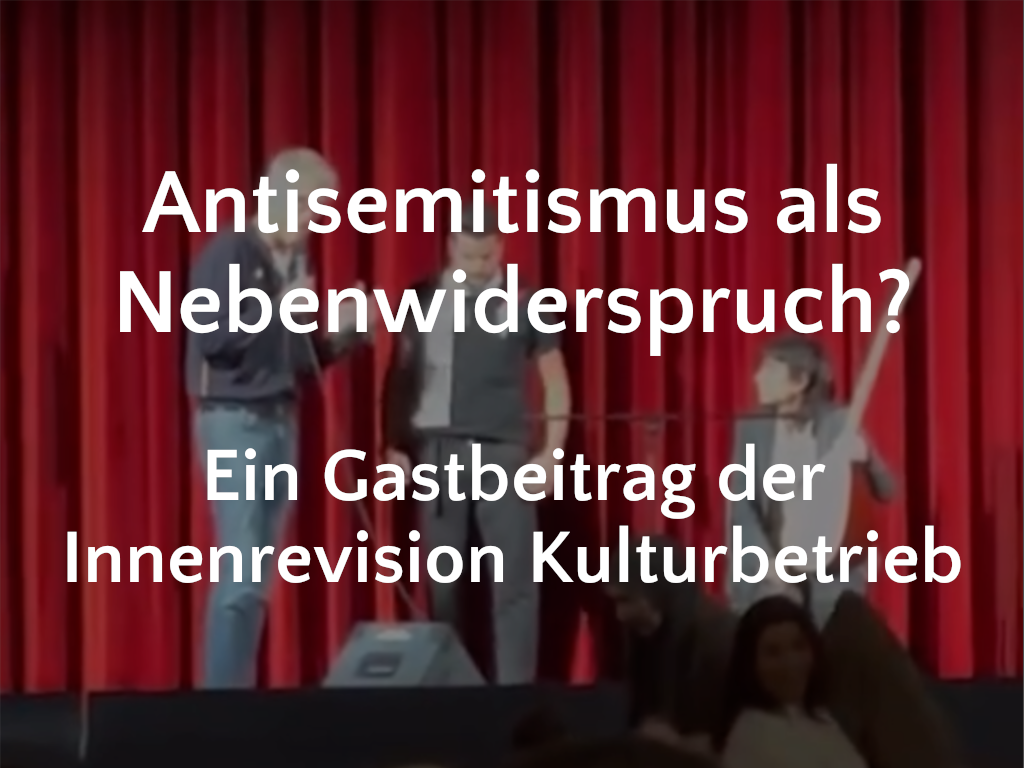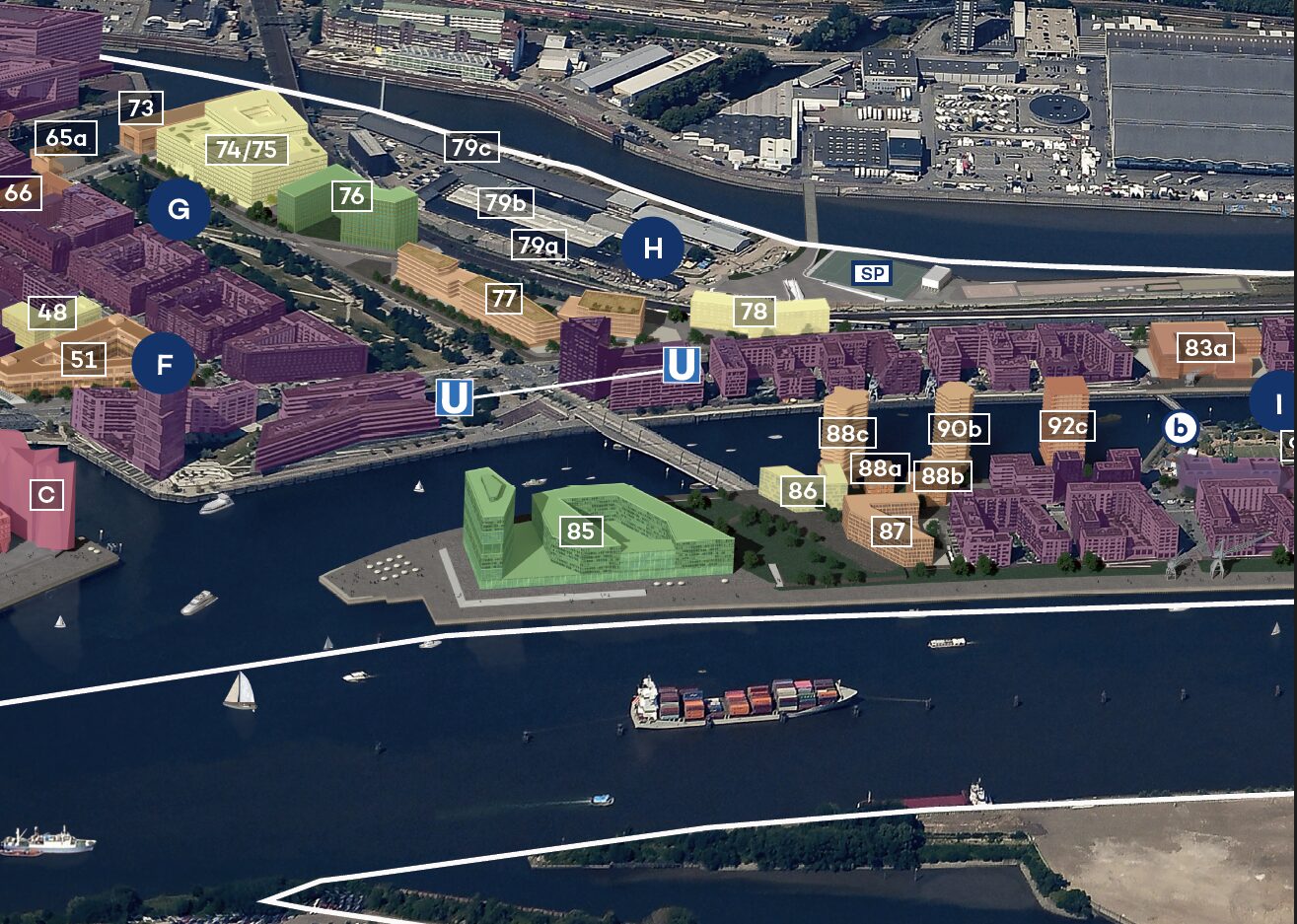Diskriminierung im progressiven Gewand – Wie der AStA der Uni Hamburg die BDS-Bewegung fördert
An der Uni Hamburg formiert sich eine BDS-Kampagne. Der AStA unterstützt sie und trägt damit zu einer israel- und judenfeindlichen Atmosphäre auf dem Campus bei. Wir haben genauer hingesehen und nachgefragt.

»Boycott, Divestment, Sanctions an der Uni Hamburg« – unter diesem Titel wurde am 24. Juli dieses Jahres per Flyer zu einer Veranstaltung in das Infocafé des Allgemeinen Studierendenausschuss (kurz AStA) auf dem Campus eingeladen. Normalerweise können Studierende hier vorbeikommen, um sich bei Problemen im Studienalltag unabhängig beraten zu lassen. Der AStA sieht sich, wie es auf der Website heißt, »ganz den studentischen Interessen verpflichtet«. Das scheint jedoch fraglich, denn die BDS-Kampagne, die im AStA offen unterstützt wird, zielt auf einen akademischen Boykott israelischer Universitäten ab und trifft auch all jene, die tatsächlich oder vermeintlich mit israelischen Institutionen zusammenarbeiten oder mit Israel assoziiert werden. Abseits der Kritik an der Bewegung insgesamt, die den einzigen jüdischen Staat delegitimieren und letztlich zerstören will, wirft das die Frage auf: Fühlt sich der AStA auch jüdischen Student:innen verpflichtet?
Die Räumlichkeiten für die BDS-Veranstaltung im Juli wurden ausgerechnet durch das »Referat für Antidiskriminierung« zur Verfügung gestellt. Das geht aus einer jüngst veröffentlichten kleinen Anfrage des RCDS an den AStA hervor. Das Referat – eine Untergliederung des AStA – stellt sich auf seiner Website als »unabhängige Anlaufstelle« dar, bei der sich Studierende »im Falle von Diskriminierung im Hochschulkontext« melden können.
Gegen Diskriminierung, aber für einen Boykott israelischer Hochschulen? Für die an der BDS Kampagne an der Universität Hamburg beteiligten Gruppen ist das kein Widerspruch. Die maßgeblichen Gruppen (»Students for Palestine Hamburg« und »Kommunistischer Studierendenbund«, der Studierendenverband der trotzkistischen Gruppe »Arbeiterinnenmacht«) bestreiten, dass ihre Kampagne antisemitisch sei. Im Gegenteil, sie soll ein Kampf für Menschenrechte sein, in einem Land, das – so Students for Palestine auf Instagram – »aktiv einen Völkermord unterstützt«. Kern der Argumentation ist stets, dass sich ihr Boykott ausschließlich gegen israelische Institutionen richte. Was könnte daran antisemitisch sein?
BDS in studentischen Räumen
Diese Frage ist auf dem Campus schon längst keine theoretische mehr. Das »BDS-Komitee« der Uni Hamburg gründete sich im Mai 2025. Doch schon zuvor gab es einschlägige Aktionen aus den es tragenden Gruppen.
Students for Palestine hatte allein im Jahr 2024 etliche Male online gegen Dozierende einer Ringvorlesung mit dem Titel »Judenfeindlichkeit, Antisemitismus, Antizionismus – aktualisierte Formen antijüdischer Gewalt« gehetzt, sich an einer Kundgebung gegen diese Veranstaltung beteiligt und an mehreren Störaktionen gegen die Ringvorlesung teilgenommen. In einer der Sitzungen unterbrachen aggressive Audioclips aus unter Stühlen versteckten Boxen wiederholt den Vortrag. Eine Gruppe jüdischer Schülerinnen konnte das nicht ertragen und verließ weinend den Raum. Die Eskalation im Rahmen der Ringvorlesungen erreichte ihren Höhepunkt, als die Frau eines Mitorganisators im Foyer des Hauptgebäudes niedergeschlagen wurde.
Aktivist:innen israelfeindlicher Gruppen haben im vergangenen Jahr mehrfach Räumlichkeiten an der Uni Hamburg genutzt, meist studentisch verwaltete Freiräume wie das Café Hübris oder das Café Knallhart. Neben den oben genannten Gruppen sind noch weitere »missionierende« Politgruppen aktiv, gegen die es kaum Widerstand gibt. Das beschreibt Simon, ein jüdischer Student der Uni Hamburg, der eigentlich anders heißt, sich aber nur anonym äußern möchte, gegenüber Untiefen.
Judenfeindliches Klima auf dem Campus
Simon hat laut eigener Aussage im November 2025 einem »Offenen BDS-Treffen« im Café Knallhart, einem weiteren studentisch verwalteten Freiraum, beigewohnt. Geleitet worden sei die Veranstaltung von einem Aktivisten des Kommunistischen Studierendenbundes. Daneben habe auch ein Mitglied von Students for Palestine gesprochen sowie eine Person, die sich selbst als Mitglied des AStA vorgestellt und Unterstützung angeboten habe, etwa einen Tisch für einen Infostand des BDS-Komitees bereitzustellen.
Der Kommunistische Studierendenbund soll den Boykott israelischer Gastdozent:innen an der Uni vorgeschlagen haben
Dabei soll auch besprochen worden sein, wie der Boykott konkret auszusehen habe. So soll der Kommunistische Studierendenbund den Boykott israelischer Gastdozent:innen an der Uni vorgeschlagen haben. Auf die Nachfrage, ob dies für alle israelische Dozent:innen gelten solle, wurde eine Ausnahme höchstens für Israelis eingeräumt, die sich aktiv gegen den israelischen Staat und für Palästina einsetzen würden. Für Simon ist das eine Gesinnungsprüfung. Und nicht nur das: Simon sagt über das Klima auf dem Uni-Gelände: »Ich fühle mich eigentlich von jeder Institution auf dem Campus im Stich gelassen. Ich weiß als jüdische Person nicht, an wen ich mich im Falle einer Diskriminierung wenden soll.«
Es gibt zwar ein offizielles »Zentrum für Antidiskriminierung« des Unipräsidiums. Auf Nachfrage versicherte der Pressesprecher der Universität, Alexander Lemonakis, gegenüber Untiefen, dort würde auch israelbezogener Antisemitismus ernst genommen. Zugleich verweist er aber in einer schriftlichen Stellungnahme auf unsere Fragen darauf, dass studentische Freiräume auf dem Campus »eigenverantwortlich von der Studierendenschaft verwaltet und studentischen Gruppen sowie Initiativen zur Nutzung überlassen [werden]. Die Verantwortung liegt daher ausschließlich beim AStA.«
Ich fühle mich als Jude absolut ausgeliefert am Campus der UHH.
Das bestätigt Simon: »Die offizielle Stelle gegen Diskriminierung hat keine Handlungsmacht gegen Antisemitismus.« Und das Antidiskriminierungsreferat des AStA? »Dorthin zu gehen, ist für mich sogar gefährlich, weil die Gefahr besteht, dass meine Daten und Aussagen an antisemitische und extremistische Gruppen weitergegeben werden.« Simon berichtet weiter, dass er erst kürzlich auf dem AStA-Weihnachtsmarkt von einer Standbetreiberin der Gruppe Students for Palestine rassistisch-antisemitisch beleidigt worden sei, ohne dass jemand eingeschritten sei. Er resümiert bitter: »Ich fühle mich als Jude absolut ausgeliefert am Campus der UHH.«

Die Rolle der Hochschulleitung
Dass die offene Diskriminierung israelischer Dozent:innen nicht vom Antisemitismus zu trennen ist, mahnte auch der scheidende Antisemitismus-Beauftragte der Stadt Hamburg, Stefan Hensel, Anfang Dezember an. In einem Instagram-Post verurteilte er die BDS-Aktivitäten an der Uni Hamburg scharf, da der Aufruf zum akademischen Boykott »die Grenzen der legitimen Debattenkultur« überschritten habe und das »Sicherheits- und Zugehörigkeitsgefühl jüdischer und israelischer Studierender, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Beschäftigter« beeinträchtige.
Gegenüber Untiefen erläuterte Stefan Hensel, wie diese Beeinträchtigung funktioniert: »Ein akademischer Boykott richtet sich zwar formal gegen Institutionen, wirkt jedoch faktisch auf Menschen, da Hochschulen soziale Räume sind. Beispielsweise durch beendete Kooperationen, zurückgezogene Konferenzeinladungen oder verweigerte Forschungsprojekte wird die akademische Zugehörigkeit israelischer und jüdischer Studierender und Forschender nicht nach individueller Haltung, sondern nach nationaler oder ethnischer Herkunft bewertet.« Mehr noch, so Hensel, beruhten akademische Boykotte »auf dem Prinzip der Kollektivhaftung, indem alle israelischen Institutionen pauschal für staatliches Handeln verantwortlich gemacht werden. Studierende müssen sich dadurch rechtfertigen, obwohl sie ja gar keine politischen Akteure sind – ihre bloße Anwesenheit wird politisiert. Dies führt häufig zu Rückzug, etwa durch das Meiden universitärer Veranstaltungen, das Verbergen der eigenen Herkunft oder den Austritt aus studentischen Gremien.«
In Reaktion auf Hensels Kritik beteuerte das Präsidium der Universität Hamburg, man habe konkrete Schutzmaßnahmen für jüdische Studierende und Beschäftigte ergriffen. Gegenüber Untiefen erläutert der Pressesprecher, neben dem genannten Zentrum für Antidiskriminierung gebe es Vertrauenspersonen für jüdische Hochschulangehörige, Fortbildungsangebote und einen intensiven Austausch mit jüdischen Institutionen in Hamburg. Jedoch enden all diese Bemühungen an der studentischen Selbstverwaltung, auf die das Präsidium keinen Einfluss hat.
Das Verhältnis des AStA zur BDS Bewegung an der Uni Hamburg
Einfluss auf den AStA hat jedoch das Studierendenparlament. Jeden Sommer wird ein neues Studierendenparlament gewählt, welches die Interessen der Studierendenschafft vertreten soll und als ausführendes Organ den AStA mit seinen Referaten einsetzt. Damit ist der AStA an die Weisungen des Studierendenparlamentes gebunden, auch bezüglich eines bereits bestehenden Unvereinbarkeitsbeschlusses mit BDS von 2017.
Angesichts der verschiedenen Veranstaltungen in den Räumlichkeiten des AStA drängt sich jedoch der gegenteilige Eindruck auf, dass sich nämlich der Allgemeine Studierendenausschuss offiziell den Zielen der BDS-Bewegung verschrieben hat. Auf eine diesbezügliche Anfrage des RCDS ließ der AStA lediglich verlauten, dass er weder Kenntnis vom Anti-BDS-Beschluss des StuPa, noch eine eigene Position zur BDS Bewegung habe.
Wir haben den AStA daraufhin am 15. Dezember gebeten, dazu Stellung zu nehmen. Warum unterstützt der AStA die BDS-Bewegung trotz anderslautendem Beschluss des StuPa? Und: Wie vereinbart das »Referat für Antidiskriminierung« seinen Auftrag damit, zugleich eine Kampagne zu unterstützen, die offen für die Diskriminierung von Israelis wirbt?
Auf unsere Anfrage konnte der AStA bis zur Veröffentlichung dieses Beitrags am 22.12. nur vermelden, dass der zuständige Vorstand leider schon im Weihnachtsurlaub sei und man daher vor Mitte Januar nicht Stellung nehme könne.
Vorbild BDS-Komitee an der FU Berlin
Ganz überraschend dürften die Antworten aber ohnehin nicht ausfallen, denn es gibt Vorbilder für die Hamburger Kampagne. Die Aktivist:innen handeln offenbar nach einem Schema, das bereits an der Freien Universität in Berlin erprobt wurde. Zunächst werden allen Verbindungen der Uni mit israelischen Institutionen erfasst. Infotische und Propagandamaterial verfolgen gleichzeitig das Ziel, Sympathie für das Thema zu erzeugen. Zudem wird insbesondere versucht, Einfluss auf die studentische Selbstverwaltung zu nehmen. Wie auch in Hamburg tun sich in der Berliner BDS-Kampagne Aktivisten der Gruppe Arbeiterinnenmacht hervor, allen voran der notorische Israelfeind Georg Ismael, der zum Beispiel den im letzten Jahr durch die Polizei aufgelösten Palästinakongress organisierte.
Diese Parallelen machen deutlich, dass jüdische Studierende der Uni Hamburg nicht nur nicht durch die studentische Interessenvertretung repräsentiert sind, sondern diese Vertretung aktiv an der Diskriminierung jüdischer und israelischer Hochschulangehöriger beteiligt ist.
Dabei ist es kein Trost, dass es offenbar die immer gleichen israelfeindlichen und zum Teil antisemitischen Aktivist:innen und Kleingruppen sind, die mit ihren Aktivitäten an den Universitäten ein israel- und judenfeindliches Klima erzeugen und in einigen Fällen Juden:Jüdinnen direkt angreifen. Denn das ist nur möglich, weil ihre antizionistische Stimmungsmache auf eine (Hochschul-)Gesellschaft trifft, die von Unsicherheiten und einem Wunsch nach einfachen, vermeintlich radikalen Erklärungen geleitet ist. Und, weil kaum jemand diesen Kleingruppen und Einzelpersonen offensiv entgegentritt.
Anna Meyer und Felix Jacob, Dezember 2025