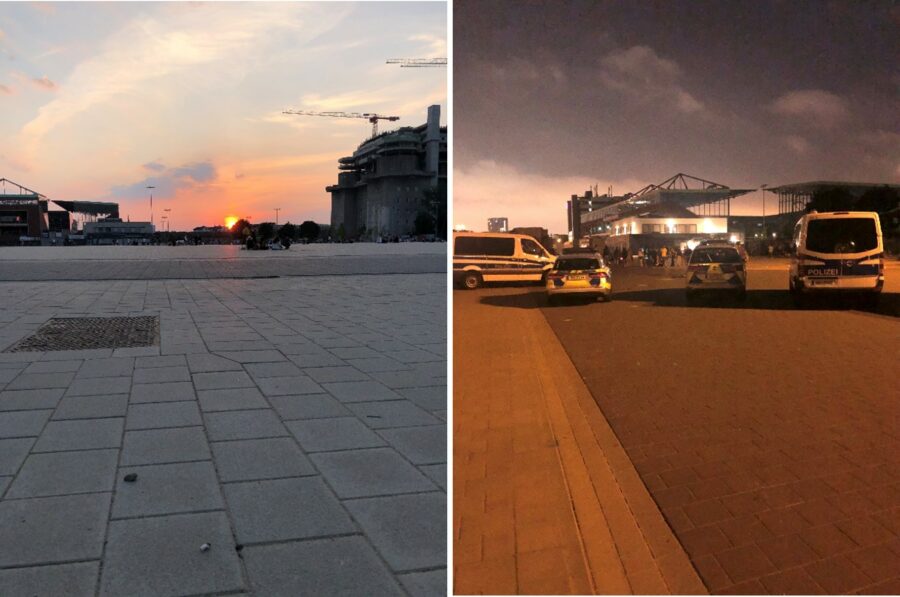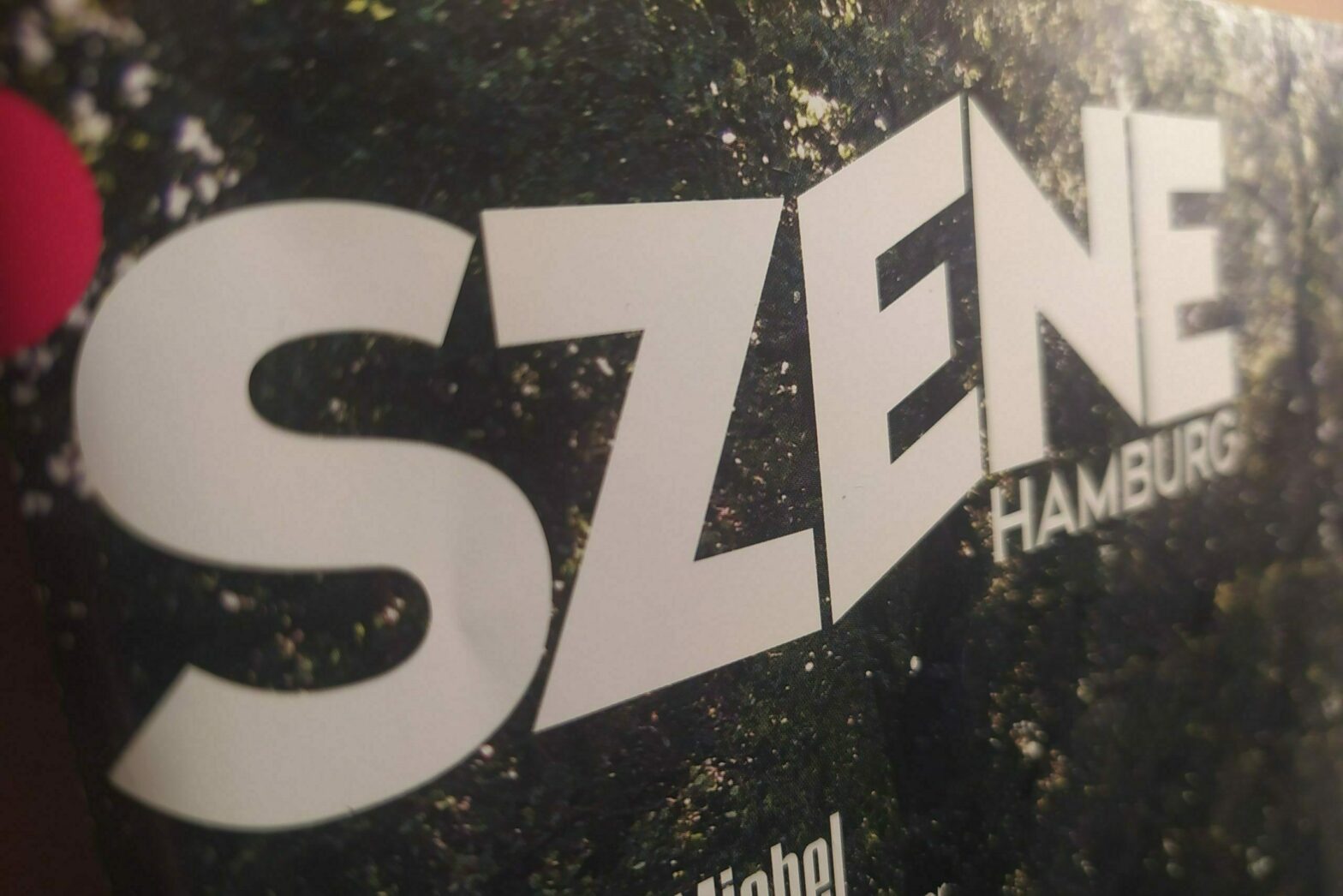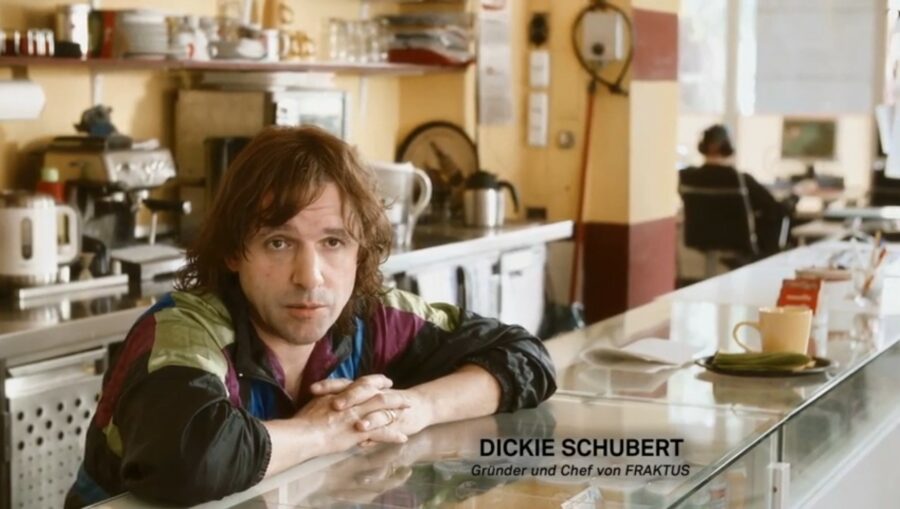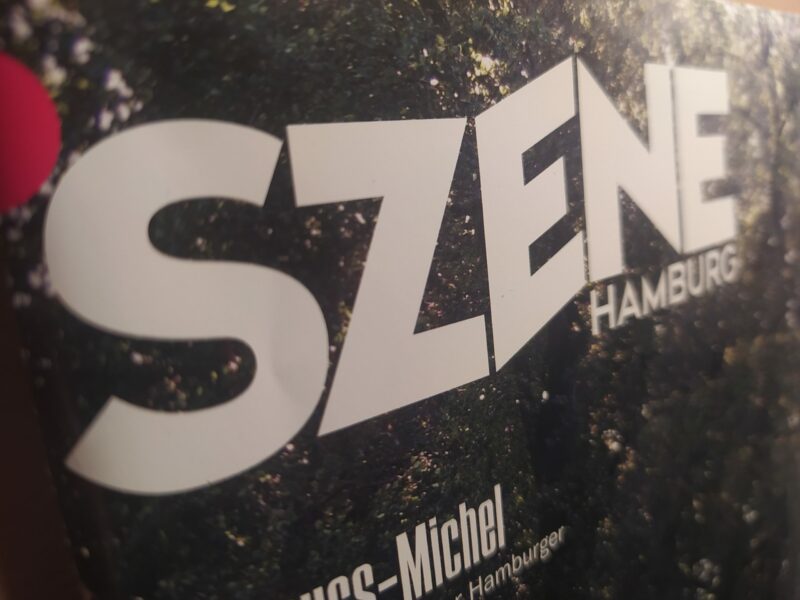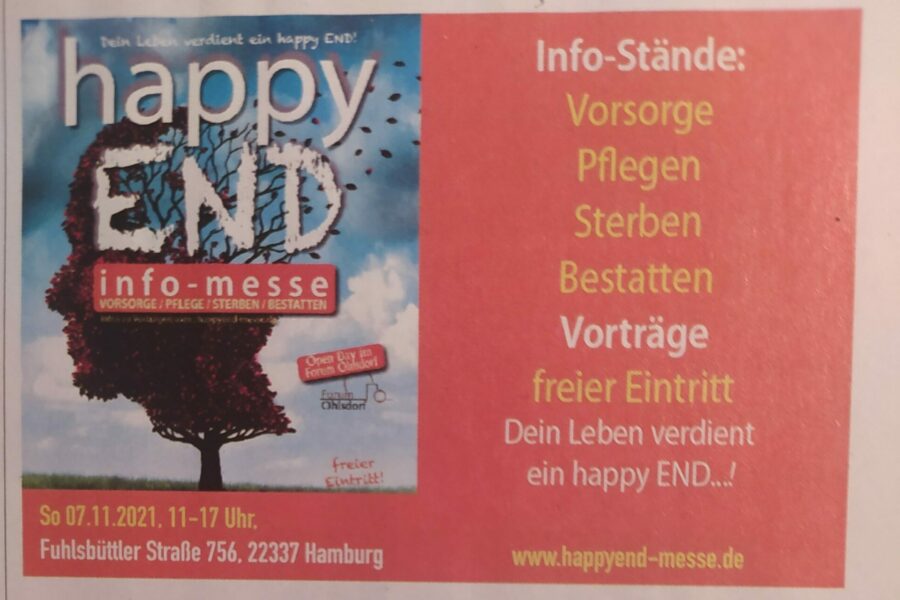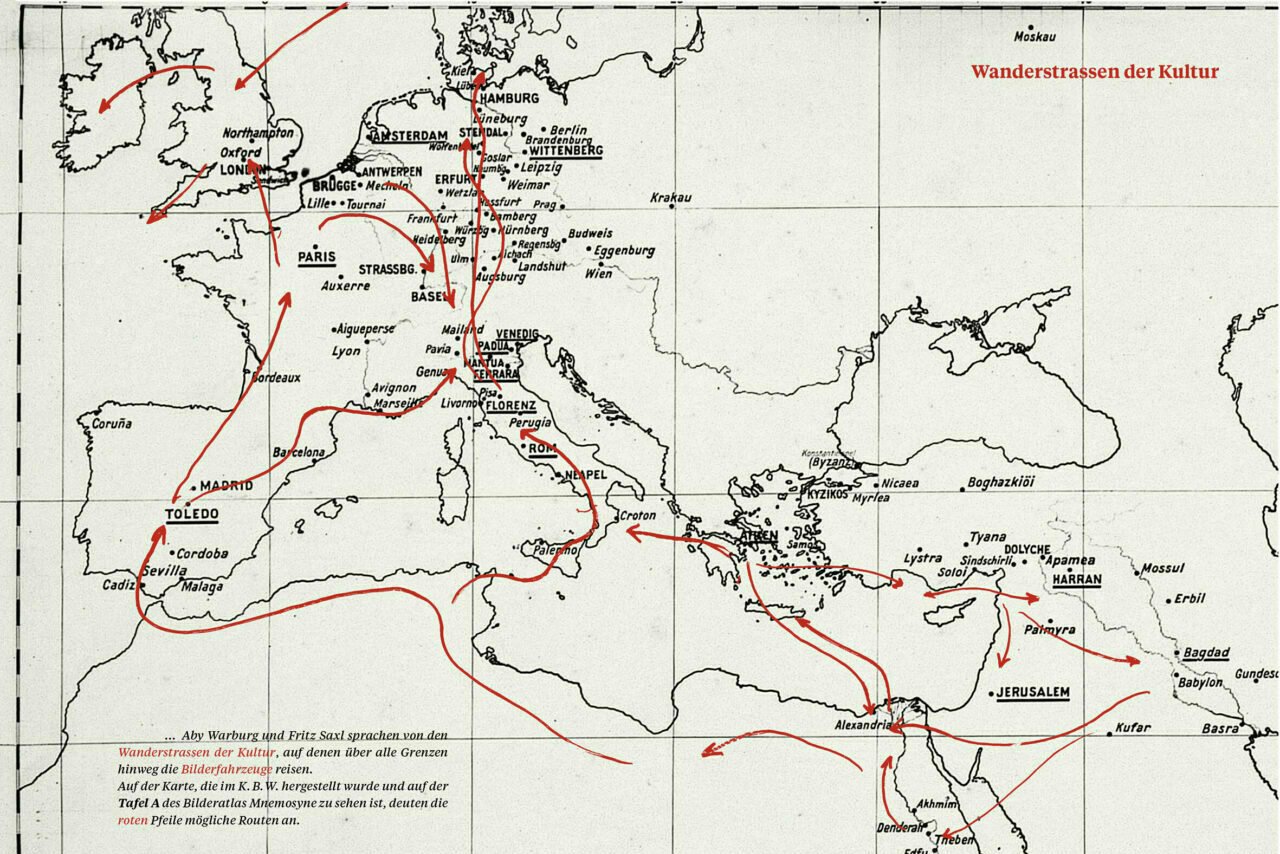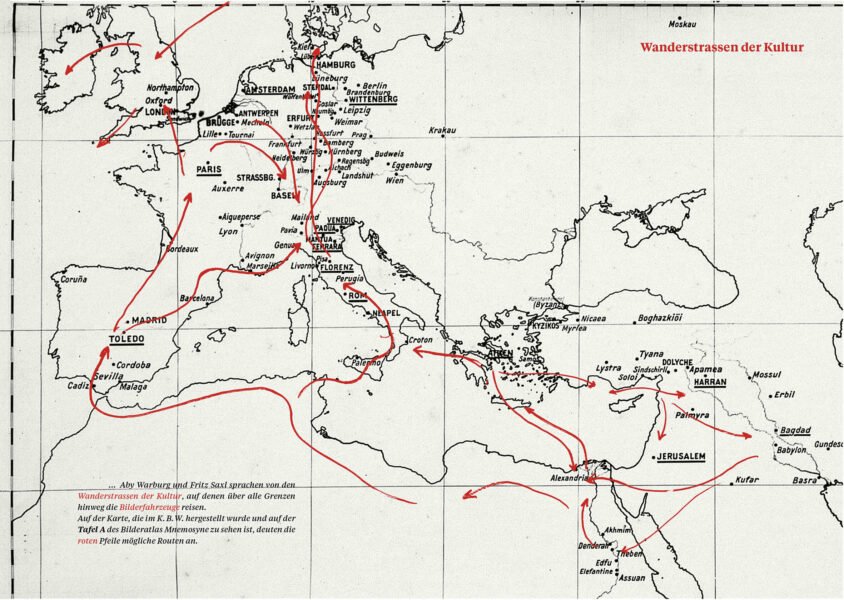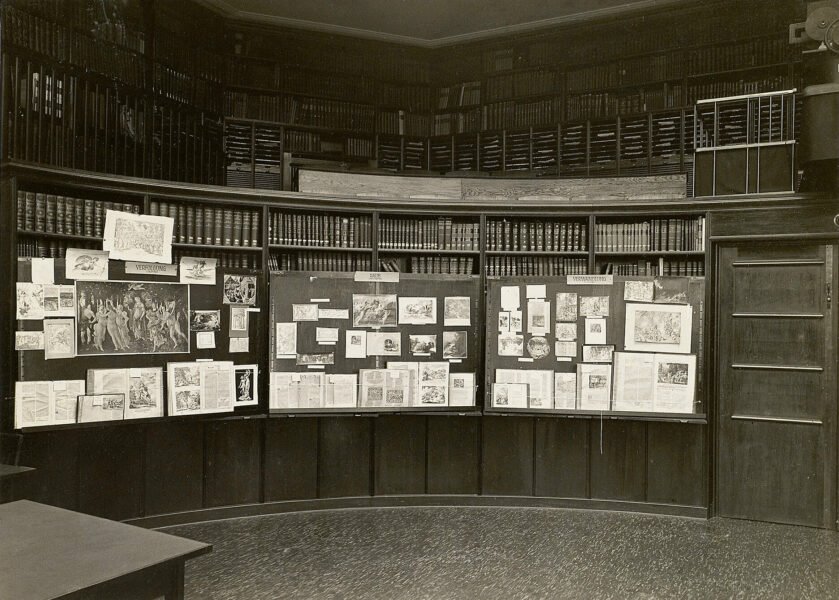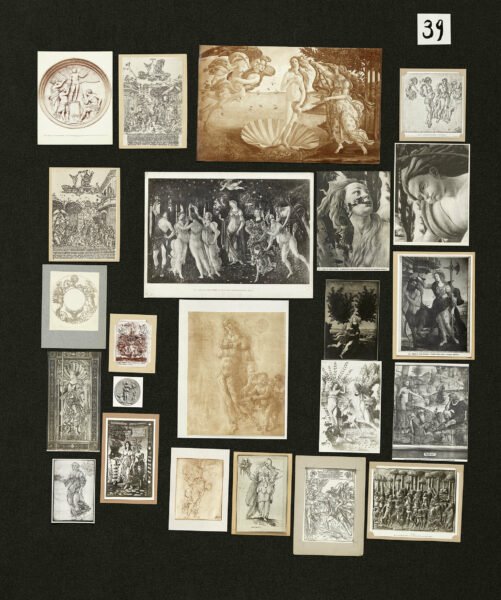Kritik, die nicht abreißt
Paulihaus, Schilleroper und Sternbrücke sind Hamburgs umstrittenste Abriss- und Bauvorhaben. In der Tat sind sie nicht zu befürworten. Trotzdem überzeugt der Protest dagegen nicht. Denn: Was spricht gegen den Abriss maroder Bauten? Ein kleiner Spaziergang wirft die große Frage auf: Wo sind die stadtplanerischen Utopien der Moderne geblieben? (Teil I)

Am Neuen Pferdemarkt, Ecke Neuer Kamp, stand im Sommer noch ein backsteinerner Flachbau – die ehemalige Kantine der Rindermarkthalle. Das Gebäude beherbergte zuletzt ein indisches Restaurant und eine Autowerkstatt. Der Ende Juni erfolgte Abriss soll Platz schaffen für ein mehrstöckiges Bürogebäude: das sogenannte Paulihaus. Würde es schon stehen, so ließen sich von den oberen Stockwerken aus die kläglichen Überreste der Schilleroper erblicken. Sie liegt nur einige Gehminuten entfernt. Im Gegensatz zur Kantine steht ihr stählernes Gerüst unter Denkmalschutz. Nach Vorstellung der Investorin soll hier ein dreiteiliger Gebäudekomplex entstehen. Wer nun von der Schilleroper aus der Stresemannstraße gen Altona folgt, findet sich bald an der Sternbrücke wieder. Eine in die Jahre gekommene Stahlkonstruktion, die ein Hauch von Bronx in Hamburg umweht und unter der eine Reihe von Clubs beherbergt sind. Sie soll, man ahnt es, in ihrer bisherigen Form abgerissen werden und einer neuen, überdimensionierten Brücke weichen.
Die nur wenige Gehminuten voneinander entfernt liegenden Gebäude weisen noch eine weitere Gemeinsamkeit auf: Sie bilden die Hauptachse städtebaulichen Protests in der Hansestadt. Um alle Bauten haben sich Initiativen gegründet, die für ihren Erhalt einstehen, oder – im Falle der Rindermarktkantine – Einspruch gegen die Neubaupläne erheben. Im Fokus der Kritik steht, aller Unterschiede zum Trotz, der Abriss alter Bausubstanz und ein Plädoyer für den Erhalt gewachsener Strukturen. So heißt es in einer 2020 verfassten Pressemitteilung der Initiative St. Pauli Code JETZT!: Die Inhaberin des vom Abriss bedrohten Restaurants an der Rindermarkthalle kämpfe »für die Erhaltung des Ortes, der so wichtig für den Stadtteil St. Pauli ist«. Im selben Jahr schrieb die Anwohner-Initiative Schiller-Oper: »Kämpft mit uns weiter für den Erhalt dieses wichtigen Stück [sic] St. Pauli! Was wäre unser Viertel ohne solche prägenden Gebäude?« Die Initiative Sternbrücke schreibt, dass die Neubauplanung der Eisenbahnbrücke das »kulturelle Herz der Schanze« zerstören würde – vorbei wäre es dann mit der »lebendigen, kleinen und historisch gewachsenen Kreuzung im Herzen von Altona Nord«.
Konservieren als Widerstand?
In der Tat: Alle geplanten Neubauten an besagten Orten trügen sicher kaum zur Lebensqualität der Bewohner:innen der betroffenen Stadtviertel bei. Sie dienten vor allem den wenigen Profiteur:innen einer Stadtplanung, die Hamburg seit über 20 Jahren als Marke begreift und Kapitalinteressen allzu gern den Vorzug lässt. Insbesondere den Neubauplänen an Rindermarkthalle und Schilleroper gilt es entschiedenen Widerstand entgegenzusetzen. Nicht zuletzt, weil die an Astroturfing – die Simulation einer Bürger:innenbewegung – grenzenden Kampagnen der Investor:innen, etwa der Schilleroper Objekt GmbH, nur allzu gut zeigen, was es bedeuten könnte, in einer vollends zur Ware gewordenen Stadt zu leben. Wohnraum ist darin nicht mehr primär ein zu befriedigendes Grundbedürfnis, sondern ein für viele unbezahlbares Lifestyleobjekt.
Die Frage ist nur: Ist das Bewahren des Alten die richtige Form des Widerstands? Ist das »historisch Gewachsene« dem rational Geplanten immer vorzuziehen? Warum sollte, um bei diesem Gebäude zu bleiben, das, was von der Schilleroper übriggeblieben ist, nicht abgerissen werden und Neuem – etwa bezahlbarem Wohnraum – weichen? Die Anwohner-Ini verweist auf die »einzigartige Stahlkonstruktion« und damit den historischen Wert des »letzten festen Zirkusbau[s] aus dem 19. Jahrhundert in Deutschland«. Die Schilleroper sei ein »für den Stadtteil prägendes« und »identitätsstiftendes Gebäude«, »ein einmaliges Stück St. Pauli«. Sie sei Teil des »kulturellen Erbes der Stadt« und müsse daher erhalten werden. Etwas anders verhält es sich mit der Kantine an der Rindermarkthalle: In jüngster Zeit richtete sich der Appell des Erhaltens, nachdem die Kantine nun abgerissen wurde, auf die mittlerweile ebenfalls gefällten 21 Bäume auf dem Gelände des projektierten Bürogebäudes. Aber könnte nicht auch hier etwas Neues entstehen, das dem Stadtteil dienlicher ist als alte Flachbauten oder ein Bürogebäude – und für das ein paar gefällte Bäume womöglich kein zu großer Preis wären?
Ist also eine Kritik, die darin aufgeht, nicht abzureißen, und dadurch von der Argumentation des Denkmalvereins nicht mehr zu unterscheiden ist, die richtige Antwort auf die bestehenden Verhältnisse? Und wieso konzentrieren sich linke stadtpolitische Bewegungen derart auf das Erhalten alter Bausubstanz? Eine Antwort lässt sich womöglich finden, wenn die lokalen Hamburger Protestherde verlassen werden und ein Blick in die Geschichte des 20. Jahrhunderts geworfen wird: In den 1970er Jahren rückte die Linke nach und nach ab von modernen Visionen großangelegter Stadtplanung und besetzte dem Verfall preisgegebene innerstädtische Bauten. Instandbesetzen und Bewahren wurden zur widerständigen Praxis. Aus der Rückschau ist dies ein Kipppunkt, der genauere Betrachtung verdient. Er kann womöglich nicht nur den heutigen Hang zum Konservieren erklären, sondern auch, warum die einstigen verkommenen Stadtviertel mittlerweile im Zentrum der Kapitalverwertung stehen.

Als die Linke in den Altbau zog
Die 1970er Jahre gelten in den Geschichts- und Sozialwissenschaften mittlerweile aus vielerlei Hinsicht als Kulminationspunkt einer Entwicklung, die nach wie vor prägend für die Gegenwart ist. Sie waren eine Übergangsphase von der klassischen Moderne zur sogenannten Post- oder auch Spätmoderne. Sie zeichnen sich durch ökonomische und kulturelle Transformationen aus, die sich in wenigen skizzenhaften Strichen mit den Schlagwörtern Deindustrialisierung, strauchelnde Wohlfahrtsstaaten und neoliberale Wende sowie ökologische Krise beschreiben lassen. Die Moderne wurde, so hat es der Soziologe Ulrich Beck formuliert, reflexiv: Nicht mehr ungebrochener Fortschritt, sondern Erkenntnis und Bewältigung der negativen Folgen des Modernisierungsprozesses selbst rückten in den Vordergrund. In der Linken zeigte sich bisweilen Skepsis an den einst gehegten revolutionären Hoffnungen und eine Hinwendung zur Innerlichkeit – so manche Mitglieder ehemaliger K‑Gruppen fanden ihren inneren Frieden bald in einer Bhagwan-Kommune.
Aus städtebaulicher Sicht drückt sich dieser Bruch im 20. Jahrhundert auch im Phänomen der Hausbesetzungen aus, die insbesondere ab den 1970er und 1980er Jahren in vielen westeuropäischen Ländern auszumachen sind. Denn während sich der Wohnungsbau auf große Siedlungen am Stadtrand konzentrierte, verfielen Altbauwohnungen in den Innenstädten und sollten oftmals Neubauplänen weichen. Die moderne, geschichtsvergessene Planungseuphorie schuf jenen Raum, innerhalb dessen sich das Bewahren alter Bausubstanz als widerständige Praxis gegen eine Baupolitik nach den Maßgaben von Staat und Kapital formierte.
Diese Baupolitik war auch verkümmertes Produkt jener in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts progressiven Idee, den beengten innerstädtischen Wohnverhältnissen proletarischer Viertel qualitativ hochwertigen und erschwinglichen Wohnraum entgegenzusetzen. Die planerischen Visionen und Utopien der Moderne waren auch eine Antwort auf jene Verwerfungen, die die Industrialisierung und der Siegeszug der neuen Produktionsweise insbesondere in den Städten hinterließen. Die Antwort bestand in der rational entworfenen Stadt, die der noch zu begründenden egalitären Massengesellschaft Raum geben sollte. In den Bauten der Nachkriegsmoderne, für die der Architekturhistoriker Heinrich Klotz den Begriff des »Bauwirtschaftsfunktionalismus« prägte, war davon nicht mehr allzu viel übrig. Zu uniform erschienen die Wohnsilos wie die Großwohnsiedlung im Hamburger Stadtteil Steilshoop oder das Neue Zentrum Kreuzberg in Berlin, die in den 1970er Jahren entstanden. Zudem lagen die meisten dieser Bauten – entgegen den ursprünglichen Intentionen moderner Stadtplanung – an den Stadtgrenzen. Hausbesetzungen waren insofern immer auch mehr als nur pragmatische Politik, um günstigen innerstädtischen Wohnraum zu erhalten. Sie waren ein Labor alternativer Lebensformen, die sich der Normierung und Regulation durch Staat und Kapital widersetzten.
Das Allgemeine und das Besondere
Die ökonomischen und kulturellen Transformationen der 1970er Jahre hat der Soziologe Andreas Reckwitz jüngst als Wendung vom Allgemeinen zum Besonderen beschrieben. Die sich ab dem 18. Jahrhundert formierende klassische Moderne sei geprägt durch eine soziale Logik des Allgemeinen: Formalisierung, Generalisierung und Standardisierung. Die Spätmoderne hingegen folge einer entgegengesetzten Logik des Besonderen: Singularisierung. Diese Analyse ist nicht nur eine weitere Erklärung für jene Prozesse der 1970er Jahre und damit auch für die Praxis des Besetzens und Bewahrens. Sie vermag auch zu zeigen, warum die einst widerständige Praxis heute Gefahr läuft, sich in ihr Gegenteil zu verkehren.
Denn was einst auch als Protest gegen die Logik des Allgemeinen begann, steht heute längst im Zentrum der Verwertung. Um wieder auf den lokalen Protest um die Schilleroper zu kommen: Sowohl die Investor:innen als auch der sich gegen deren Pläne formierende Protest operieren, aller Unterschiede in der Zielsetzung zum Trotz, im selben strategischen Feld. Die Schilleroper Objekt GmbH spricht von der »besondere[n] Bedeutung im Quartier des Stadtteils St. Pauli« und von einem »traditionelle[n] Areal«. Die GmbH imitiert hier nicht nur den Sound der Anwohner:innen-Ini: Vielmehr stehen das Singuläre und Einzigartige des Ortes im Zentrum von dessen Vermarktung und Verkauf. Und auf der anderen Seite unterscheidet sich der vom Architekten Dirk Anders gemeinsam mit der Schilleroper-Ini vorgelegte Alternativentwurf kaum von ähnlichen städtebaulichen Strategien, historische Bausubstanz als dekoratives Element zu bewahren, um dem Neuen ein »historisches Flair« zu verschaffen. Ein flüchtiger Blick in die Exposés von Immobilienfirmen reicht aus: Das »andere Leben«, die »gewachsenen Viertel«, Subkultur und alternative Urbanität sind offenbar gute Argumente, um überteuerte Eigentumswohnungen zu verkaufen.
Auch das Paulihaus – oder besser: das Areal, auf dem es gebaut werden soll – weist in diese Richtung. Bis zum Jahr 2010 beherbergte die heutige Rindermarkthalle noch die Filiale einer großen Supermarktkette. Das Backsteingebäude war weitgehend mit weißem Trapezblech verkleidet. Es hätte in dieser Form auch an jeder anderen Ecke dieser oder in einer beliebigen Stadt stehen können. Es war, wie sein Inhalt, austauschbar. Nach dem Auszug des Supermarktes entstand eine Debatte um die Nutzung der Fläche. Gegen die Abrisspläne der Stadt – es sollte eine Konzerthallte entstehen – entstand so großer Widerstand, dass man sie schließlich verwarf. Das Trapezblech wurde entfernt, das Backsteingebäude saniert, die alten Reliefs wiederhergestellt. Nun war es nicht mehr irgendein beliebiges Gebäude, sondern es hatte Wiedererkennungswert. Die Rindermarkthalle St. Pauli ist nun ›einzigartig‹, mit ›Tradition‹ und ›Geschichte‹. So werden sie und die sich in ihr mittlerweile zu findenden Geschäfte auch vermarktet. Die »ganze Vielfalt St. Paulis auf einem Fleck«, heißt es auf der Webseite. Gemeint sind Einkaufsmöglichkeiten.

Das Besondere, das Erhalten des historisch Gewachsenen, die Betonung von Identität, sind zu den Koordinaten eines kulturellen Systems geworden, das nicht mehr das Andere kapitalistischer Verwertung sucht, sondern mittlerweile in ihrem Zentrum steht. Jene Räume, in denen auch eine widerständige, sich nicht fügen wollende Subkultur entstand, verlieren nach und nach jegliches Moment von Nichtidentität und werden sowohl zur Bühne als auch zum konsumierbaren Beifang des Erwerbs von Eigentumswohnungen – oder handgemachter Backwaren. Und nun? Zurück zu Trapezblech und Beton?
Womöglich wäre es ein Weg, einen Teil der nichteingelösten Versprechen der Moderne, auch in Stadtplanung und Architektur, freizulegen und sie auf den Trümmern abgerissener Stahlkonstruktionen und Flachbauten entstehen zu lassen. -Fortsetzung folgt-
Johannes Radczinski, Januar 2022
Der Autor plädierte auf Untiefen bereits für den Abriss (oder zumindest die Umgestaltung) des Bismarckdenkmals und dafür, das Heiligengeistfeld ganzjährig als Freifläche den Bewohner:innen dieser Stadt zur Verfügung zu stellen.