Chronik antisemitischer Vorfälle in Hamburg seit dem 7. Oktober 2023
Seit dem Massaker der Hamas am 07. Oktober 2023 gibt es auch in Hamburg eine Welle antisemitischer Vorfälle. Wir haben gemeinsam mit dem Bildungsverein Bagrut e.V. eine Chronik über das vergangene Jahr erstellt, um das Ausmaß und die Formen des Antisemitismus sichtbar zu machen.
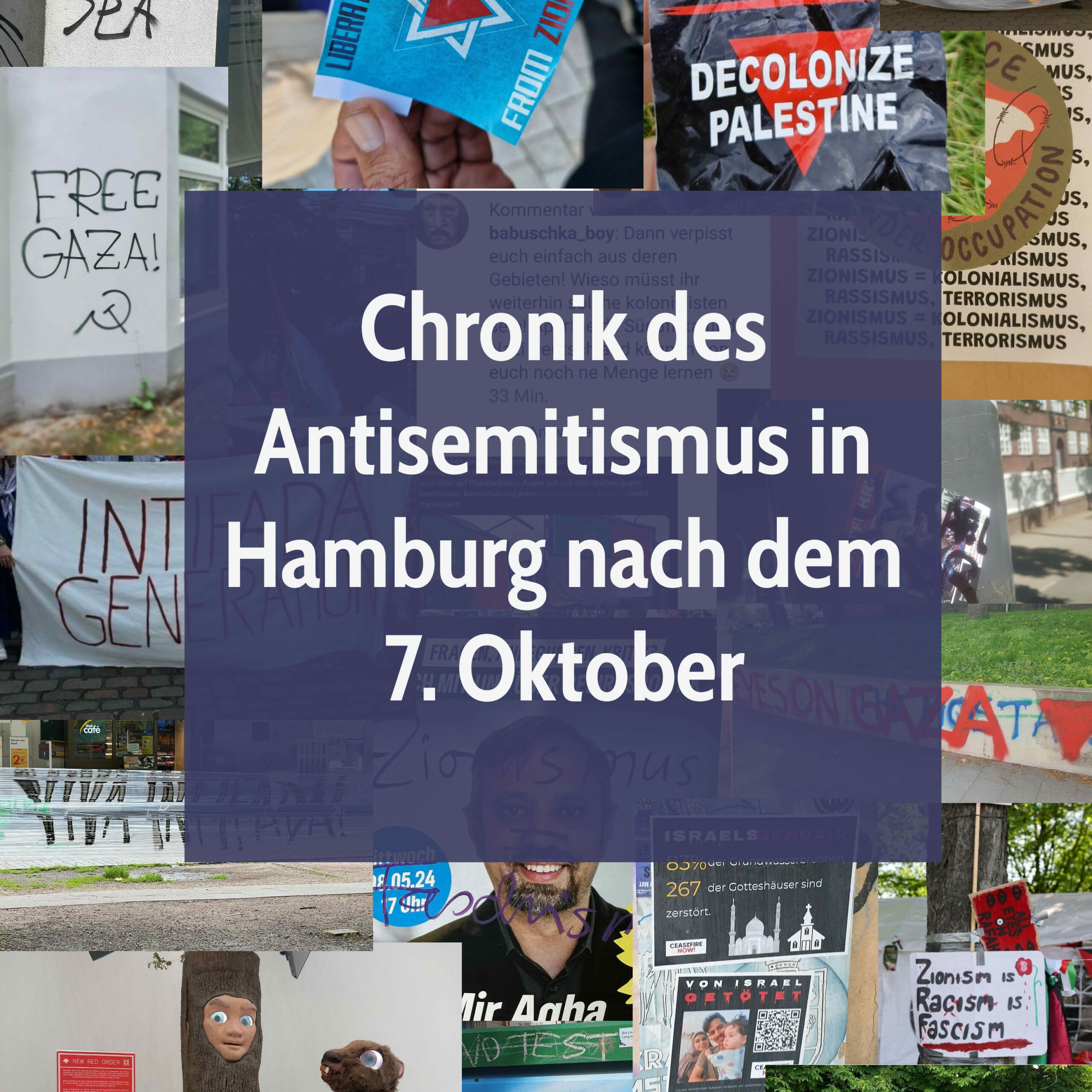
Am 7.10.2023 verübte die islamistische Terrororganisation Hamas auf israelischem Boden ein genozidales, antisemitisches und misogynes Massaker. Die grausame und wahllose Ermordung von 1.200 Menschen, die Vergewaltigung zahlreicher Frauen und die Entführung von 250 Personen bedeuteten eine Zäsur selbst in der an gewaltvollen Ereignissen kaum armen Geschichte des Judenhasses. Die libanesische, vom Iran gesteuerte Miliz Hisbollah startete am 8.10.2023 in Solidarität mit der Hamas eine neue Angriffswelle gegen Israels Norden; die Houthi-Milizen im Jemen schlossen sich mit ähnlichen Angriffsversuchen an. Die militärische Reaktion der israelischen Streitkräfte dauert bis heute an. Die Kämpfe haben im Gazastreifen bereits viele Tausend zivile Opfer gefordert und große Teile der dortigen Infrastruktur zerstört.
Weltweit, und auch in Hamburg, formierte sich nach einer nur kurzen Schockstarre eine Welle antisemitischer und israelfeindlicher Gewalt in Wort und Tat – auf Wänden, auf den Straßen, in den Hörsälen, in den digitalen Medien. Die Gewalt richtet sich gegen (vermeintliche) Jüdinnen und Juden, gegen (vermeintlich) jüdische und israelische Einrichtungen, gegen mit Israel solidarische oder auch lediglich antisemitismuskritische Demonstrierende, Aktivist:innen oder Künstler:innen, Kulturzentren, Clubs oder Bars und viele weitere.
Die Folgen für jüdisches Leben in Hamburg
Welche Folgen dieses gewalttätige Klima für Jüdinnen und Juden in Hamburg hat, berichtete uns eindrücklich Rebecca Vaneeva. Sie ist derzeit Präsidentin des Verbands jüdischer Studierender Nord. Die Zunahme antisemitischer Anfeindungen führt ihr zu Folge unter den Mitgliedern ihres Verbandes zu einem Rückzug in die Anonymität. Jüdische Identität wird versteckt. Im öffentlichen Auftreten zensieren Jüdinnen und Juden sich zunehmend selbst, um keine Angriffsfläche zu bieten: »Besonders an den Hochschulen war die ständige Präsenz israelfeindlicher und antisemitischer Proteste schwer erträglich«, so Vaneeva.
Besonders an den Hochschulen war die ständige Präsenz israelfeindlicher und antisemitischer Proteste schwer erträglich
Gegenüber dem Zeitraum vor dem 07. Oktober hat sich in ihrer Wahrnehmung die Lage »auf jeden Fall verschlimmert«. Vaneeva kritisiert gegenüber Untiefen: »Jüdische Studierende und unser Verband erfahren zwar vereinzelt Solidarität, aber es gibt keine aktive Gegenbewegung gegen Antisemitismus.« Woran fehlt es aus ihrer Sicht konkret? »Es bräuchte Safe Spaces, Anlaufstellen, die konsequente Moderation von Online-Inhalten und auch strafrechtliche Konsequenzen für Terror-Propaganda. Würde das ähnliche engagiert verfolgt wie etwa die rassistischen Gesänge in dem berüchtigten ›Sylt-Video‹, wäre schon viel gewonnen«. Die Hochschulen machen es sich ihrer Meinung nach etwa bei antisemitischen und israelfeindlichen Verstaltungen zu bequem. Terror-relativierende Seminare und Vorträge, die unter dem Deckmantel von Hochschulgruppen nahezu anonym organisiert werden können, werden fast immer toleriert, selbst wenn einschlägige Aktivist:innen beteiligt sind.
Es gibt einen verbreiteten Selbstbetrug über die Komplexität des Phänomens Antisemitismus.
Den Umgang mit den verschiedenen Formen von Antisemitismus bezeichnet Rebecca Vaneeva insgesamt als »selektiv«, denn: »Es gibt einen verbreiteten Selbstbetrug über die Komplexität des Phänomens Antisemitismus. Rechtsextremer Antisemitismus wird zum Glück weitgehend verurteilt. Es handelt sich aber auch um ein muslimisches und ein linkes Phänomen. Unsere Mitglieder berichten uns, dass sogar die Mehrzahl der Anfeindungen, die sie erleben, aus muslimischen und linken Milieus kommen«.
Wie ist die Datenlage in Hamburg?
Dieser »selektive Umgang« wird in Hamburg auch dadurch gestützt, dass es, anders als in anderen Bundesländern, keine öffentliche Dokumentation antisemitischer Vorfälle gibt. Abseits der v.a. durch Kleine Anfragen in der Hamburgischen Bürgerschaft[1] veröffentlichten Daten der Polizei, die auf zur Anzeige gebrachten Delikten von Hasskriminalität basieren, existiert offenbar keine systematische Sammlung. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum haben sich laut diesen Daten die Fälle antisemitischer Hasskriminalität im 4. Quartal 2023 verfünffacht. Bundesweite Zahlen des Bundeskriminalamts zur „politisch motivierten Kriminalität“ (PMK) und des Bundesverbands Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus (RIAS) weisen in dieselbe Richtung.
Das zivilgesellschaftliche Monitoring betreibt in Hamburg die 2021 gegründete, öffentlich geförderte digitale Hinweis- und Meldestelle memo. Sie veröffentliche allerdings bislang die Fallzahlen für rechte, rassistisch und antisemitisch motivierte Angriffe nur zusammengefasst. In einem im Sommer 2024 vorgelegten Bericht veröffentlichte die Trägerin der Meldestelle, die Beratungsstelle empower, für 2023 genauere Zahlen und berichtete 282 dort bekannt gewordene Fälle von Antisemitismus in Hamburg. Nach dem 7. Oktober verzeichnete man auch hier einen starken Anstieg.
Aber: Alle verfügbaren Daten deuten darauf hin, dass es ein großes Dunkelfeld gibt. In einer ebenfalls im Sommer 2024 veröffentlichten Studie der Akademien der Polizei Hamburg und Niedersachsen gaben 77 % der befragten Hamburger Jüdinnen und Juden an, innerhalb des vergangenen Jahres Antisemitismus erfahren zu haben. Die Studie schätzt den Anteil unbekannter Fälle auf 80 %. Und: die Daten verraten nichts über die konkreten Fälle. Wer sind die Täter, wer die Geschädigten? Welche Ideologien stehen jeweils dahinter?
Eine öffentliche Chronik für das Jahr nach 07/10
Aufgrund dieser offenen Fragen haben wir uns entschlossen, selbst eine Chronik antisemitischer Vorfälle in Hamburg seit dem 7. Oktober 2023 anzulegen. Damit wollen wir einen Eindruck vom Ausmaß und den verschiedenen Formen des Antisemitismus in Hamburg vermitteln. Und Entgleisungen in Erinnerung halten, die meist allzu schnell in Vergessenheit geraten. Wir haben dazu aus verschiedenen Quellen eine Liste von derzeit 187 antisemitischen Vorfällen für den Zeitraum 7.10.2023 bis 7.10.2024 zusammengestellt. Darunter sind Presseberichte, online dokumentierte Vorfälle, persönliche Berichte aus der jüdischen Community und von anderen Betroffenen sowie die genannten, durch die Anfragen in der Bürgerschaft veröffentlichten Quartalszahlen zu Hasskriminalität. Diese Momentaufnahme für das Jahr nach dem 7. Oktober kann und will aber natürlich nicht eine systematische Erhebung und ein entsprechendes institutionalisiertes Monitoring ersetzen. Das bleibt notwendig.
Was wir erfasst haben – und was nicht
Bekanntlich ist die Frage, was als antisemitisch einzuordnen ist, durchaus umstritten. Wir haben uns an der Arbeitsdefinition Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) von 2019 sowie der Systematik des Bundesverbands RIAS orientiert. Diese unterscheidet „verletzendes Verhalten“, „Bedrohung“, „Angriff“, „(extreme) Gewalt“, „(gezielte) Sachbeschädigung“ und „Massenzuschriften“. Das bedeutet, die Fälle reichen potenziell von einschlägigen Äußerungen oder antisemitisch motivierten Veranstaltungen bis hin zu körperlicher Gewalt.
Bei einigen Vorfällen, die wir recherchieren konnten, ist nicht ohne Weiteres zu klären, ob sie nach der verwendeten Systematik antisemitisch genannt werden können.[2] Meist deshalb, weil über den Kontext und/ oder den konkreten Ablauf wenig bekannt ist. Wir haben daher nur Fälle aufgenommen, bei denen der antisemitische Gehalt bzw. eine entsprechende Intention deutlich erkennbar ist. Um unserer Verfahren transparent zu machen, haben wir in Anhang 1 (unter der Tabelle) drei Beispiele für Fälle, deren Kategorisierung wir intensiver diskutiert haben, zusammengestellt und unsere Entscheidung kurz skizziert.
Nicht aufgenommen haben wir etwa einige Fälle von – gleichwohl eindeutigem – Israelhass. Das meint die Dämonisierung Israels, z.B. als »Apartheidstaat« oder als »kolonial«, die durchaus in der Praxis meist antisemitisch, d.h. judenfeindlich gemeint sein kann bzw. die praktisch oft eine solche Wirkung hat. Ähnlich sind wir mit einigen offensichtlich falschen Darstellungen des 7. Oktobers (etwa als bloße Verteidigung, als Widerstand o.Ä.) umgegangen. Unser Hauptaugenmerk lag darauf, eine möglichst konsistente Liste zu erzeugen.
Das bedeutet auch: nicht nur gab es mit Sicherheit in Hamburg seit dem 7. Oktober 2023 mehr Fälle der Art, wie wir sie zusammengetragen haben. Sondern Antisemitismus bedient sich im gegenwärtigen kulturellen Klima noch weiterer Sujets und Techniken. Dass sie nicht immer eindeutig als antisemitisch erkennbar sind, ist dabei durchaus beabsichtigt – und Teil des Problems im Umgang mit dem Antisemitismus. Er ist nach Auschwitz in der BRD – noch – mit einem öffentlichen Tabu belegt und wird eher indirekt geäußert. Die Kommunikation auf Umwegen, in Codes, Schlagworten und auf Einverständnis zielenden Andeutungen dient dazu, dieses Tabu zu umgehen. Kaum jemand bezeichnet sich selbst als Antisemiten. Im Gegenteil wird der Hinweis auf antisemitische Gehalte und Wirkungen in der Praxis allzu oft als „Antisemitismusvorwurf“ abgewehrt.[3]
Schlussfolgerungen
Unsere Liste bestätigt die politische Einschätzung Rebecca Vaneevas: bei den von uns recherchierten Fällen handelt es sich, soweit erkennbar, vielfach um selbsterklärt „pro-palästinensisch“, also nationalistisch und/oder antiimperialistisch gerechtfertigte Taten. Der rechtsextreme Antisemitismus mit positivem Bezug auf den Nationalsozialismus oder als Relativierung des Holocausts sowie ein Alltagsantisemitismus aus der „Mitte der Gesellschaft“ (z.B. Juden seien „ganz anders als wir“) spielen allerdings nach wie vor eine nicht zu unterschätzende Rolle.
In der untenstehenden Tabelle haben wir nicht alle 187 Fälle aufgenommen, sondern nur exemplarische, die die verschiedenen Formen des Antisemitismus und ihre Gewichtung in Hamburg möglichst gut illustrieren. Der vollständige Datensatz kann auf Anfrage zugänglich gemacht werden.
Unsere Sammlung für das Jahr nach dem 7. Oktober 2023 kann aus den genannten Gründen keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Repräsentativität erheben. Die allermeisten Vorfälle werden nie gemeldet oder öffentlich bekannt. Daher möchten wir Sie herzlich bitten: Bringen Sie entsprechende Fälle ggf. zur Anzeige und melden Sie sie in jedem Fall einer Meldestelle wie dem Bundesverband RIAS. Falls Sie von weiteren Vorfällen im zurückliegenden Jahr in Hamburg wissen, berichten Sie uns bitte davon. Wir werden die Chronik dann aktualisieren.
Ein gemeinsames Projekt von Untiefen und dem Bildungsverein Bagrut e.V., bearbeitet von Felix Breuning und Florian Hessel.
| Wann? | Was? | Wo? | Quelle |
|---|---|---|---|
| 10/8/2023 | Antisemitischer Kommentar auf der Instgram-Seite von Bagrut e.V.: »Dann verpisst euch einfach aus deren Gebieten! Wieso müsst ihr weiterhin solche kolonialisten [sic!] sein! Apartheids Südafrika und Nazi Deutschland können von euch noch ne Menge lernen [weinendes Emoji]« | Ottensen | Instagram |
| 10/9/2023 | Übergriff auf israelsolidarische Demonstrantinnen »In Hamburg sind nach einer Solidaritätskundgebung für Israel zwei Teilnehmerinnen angegriffen worden. […] Die beiden 32 und 47 Jahre alten Frauen waren nach der Kundgebung mit dem Abbau beschäftigt, als sie plötzlich attackiert wurden. Zwei junge Männer griffen sie von hinten an, schlugen und traten auf die Frauen ein. Dabei rissen sie ihnen auch eine Israel-Flagge aus der Hand und trampelten auf ihr herum.« | Altstadt | NDR |
| 10/20/2023 | Antisemitische Flyer in St. Georg »Einige Menschen verteilten dort [vor den gut besuchten Moscheen im Stadtteil St. Georg] Flyer, auf denen die Angriffe Israels auf den Gaza-Streifen kritisiert wurden.« Darauf verwendete Ausdrücke sind u.a.: »Verbrecherische Zionisten«, »Zionistengebilde«, »Genozid«. (Anm.: Der Begriff »Zionistengebilde« ruft das antisemitische Klischee auf, Juden wären nicht zum Aufbau eines »normalen« Staates fähig und/oder spricht dem Staat grundsätzlich das Existenzrecht ab.) | St. Georg | NDR |
| 10/20/2023 | NDR-Moderator und Centralcongress-Betreiber Michel Abdollahi nutzt in IG-Video antisemitische Stereotype, behauptet u.a., Israel wolle den Menschen im Gaza-Streifen »bis zum letzten Blutstropfen alles wegnehmen«. | Altstadt | X (Twitter) |
| 10/23/2023 | Ausschreitungen und Parolen in Harburg: »Am Montagabend hat es in Hamburg-Harburg Randale von Jugendlichen und jungen Männern gegeben. Vor Ort wurden rechtsextreme und israelfeindliche Botschaften verbreitet. Nach Angaben der Polizei versammelten sich ab 18 Uhr rund 40 Jugendliche und junge Männer am Harburger Ring. Bis 1 Uhr nachts sollen sie dort für Unruhe gesorgt haben. Unter anderem sprayten die Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 21 Jahren israelfeindliche Parolen und zündeten offenbar auch Böller. Die Polizei spricht von politisch motivierten Straftaten im Zusammenhang mit den Nahost-Konflikt. Vor Ort äußerten sich einige Jugendliche rechtsextrem und israelfeindlich. Andere sagten, sie wollten ein Zeichen dafür setzen, dass sie auf der Seite von Palästina stünden und sich solidarisch zeigen.« | Harburg | NDR |
| 10/24/2023 | Plakatzerstörung an der Roten Flora: »Unbekannte [haben] das riesige Solidaritätsplakat [für die Opfer des Massakers am 7. Oktober] an der Flora-Fassade überklebt, die Worte „Jüdinnen“ und „Juden“ wurden entfernt. Viele Betrachter sind empört.« | Sternschanze | Mopo |
| 10/27/2023 | Die organisierenden Gruppen einer geplanten »Anti-Repressionsparty« im Centro Sociale (u.a. das Offene Antifaschistische Treffen Hamburg (OAT)), wollen sich nicht von den mitorganisierenden »Young Struggle« distanzieren, obwohl diese zuvor auf ihrer Website einen Artikel veröffentlicht haben, der das Massaker vom 07. Oktober 2023 als »Gefängnisausbruch des palästinensischen Volkes« verharmlost und legitimiert. Das Nutzer:innenplenum sagt daraufhin die Veranstaltung ab. | Sternschanze | Jungle World |
| 10/28/2023 | Islamistische Versammlung in St. Georg: »Etwa 500 Menschen haben sich am Sonnabend auf dem Steindamm im Hamburger Stadtteil St. Georg versammelt. Angeblich um für die Palästinenser und Palästinenserinnen im Gazastreifen zu demonstrieren. Doch hinter dem gewaltsamen Protest steckten offenbar radikale Islamisten. […] Die ausschließlich männlichen Demonstranten hätten außerdem dazu aufgerufen, auch in Deutschland die Scharia, das islamische Recht, einzuführen. Darüber hinaus sei die Rede davon gewesen, das Blut der Palästinenser und Palästinenserinnen in Gaza auch hier in Deutschland zu rächen.« | St. Georg | NDR |
| 11/1/2023 | Anruf in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme: »Anrufer meldet sich mit ›Adolf Hitler‹ und verstellter Stimme… ›Steht denn die Dusche noch?‹, auf Nachfrage Wiederholung« | Neuengamme | Mitteilung Gedenkstätte |
| 11/9/2023 | Ganzseitiger Eintrag “Free Palestine” im Besucherbuch der Gedenkstätte Bullenhuser Damm (erinnert an 20 jüdische Kinder und mindestens 28 Erwachsene, die am 20. April 1945 im Keller des Gebäudes von SS-Männern ermordet wurden) | Mitte | Zeug*in |
| 11/11/2023 | Bombendrohung gegen Jüdisches Bildungszentrum (»Vor dem Jüdischen Bildungszentrum an der Rothenbaumchaussee hat ein unbekannter Mann per App ein Taxi bestellt; über die Chatfunktion schickt er dem Fahrer mehrere Nachrichten, behauptet unter anderem, er habe Sprengstoff in der Synagoge Hohe Weide platziert; er spricht von angeblichen erfolgten Straftaten, droht Taten an. Der Taxifahrer alarmiert die Polizei. Auf dem von der Polizei bewachten Gelände der Synagoge befindet sich zu dieser Zeit eine kleine Gruppe jüdischer Menschen; sie verbringen nach Abendblatt-Informationen eine Stunde voller Angst in einem Keller, bis die Polizei Entwarnung gibt. […] Es hätten sich keine Hinweise auf ›konkrete Gefährdungssituationen‹ ergeben, teilt die Polizei auf Anfrage mit. Gleichwohl laufen strafrechtliche Ermittlungen, geführt von der Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamts.« | Rotherbaum | Abendblatt |
| 11/21/2023 | Antisemitische, nationalsozialistische Schmiererei (»NSDAP«) auf Plakatwand, die über jüdisches Leben (»Ist Chanukka das jüdische Weihnachten?«) informiert | Altona | X (Twitter) |
| 11/26/2023 | Großflächig rote Farbe auf das Synagogenmahnmal und Gestecke in Harburg gesprüht | Harburg | Zeug*in |
| 1/19/2024 | Rote-Hände Graffito in Kombination mit einer Palästinaflagge. (Die roten Hände beziehen sich positiv auf einen Lynchmord an israelischen Soldaten zu Beginn der Zweiten Intifada im Jahr 2000) | St. Pauli | Zeug*in |
| 1/25/2024 | Palästinaflagge mit Aufschrift »Free Gaza from Wiedergutmachung« (Der Slogan fordert ein Ende der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit und/ oder suggeriert, diese würde im Dienste Israels bzw. gegen die Palästinenser geschehen) | Winterhude | ZEIT/Elbvertiefung Newsletter |
| 1/25/2024 | Keynote der antizionistisch-antisemitischen Klimaaktivistin Zamzam Ibrahim im Rahmen der Klima-Tagung »How Low Can We Go« auf Kampnagel. Ibrahim unterstützte zuvor bekanntermaßen die antisemitische BDS-Kampagne gegen Israel, setzte Israel mit dem NS gleich und legitimierte öffentlich den Terror von Hamas und Huthi-Rebellen. Sie trat u.a. im iranischen Staatsfernsehen auf. | Winterhude | Bericht Untiefen |
| 1/25/2024 | Gegendemonstration zu einer israelsolidarischen Demonstration vor Kampnagel, skandiert wird laut der ZEIT u.a. »Free Palestine from Wiedergutmachung« | Winterhude | Bericht Untiefen, ZEIT Newsletter |
| 1/28/2024 | »Der Verurteilten wurde vorgeworfen, am 28. Januar 2024 im Valentinskamp einer pro-israelischen Versammlungsteilnehmerin u.a. eine mitgeführte Israel-Flagge entrissen zu haben. Im Strafbefehlswege wurde sie zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen wegen Nötigung verurteilt.« | Neustadt | Mitteilung Staatsanwaltschaft |
| 1/31/2024 | Im Rahmen einer Podiumsdiskussion in den Bücherhallen tritt ein Störer auf, beleidigt nach Aufforderungen, den Raum zu verlassen, die jüdischen Diskutantinnen als »Nazis« und proklamiert, er lasse sich von ihnen »nicht ins KZ sperren«. Ein physischer Übergriff kann vom Moderator verhindert werden. | St. Georg | Zeug*in |
| 2/4/2024 | Parolen an einem Privathaus: »We stand with Palestine – Genocide apologists – zionists + other racists not welcome«; nach Mitteilung zuvor bereits angebracht: »Israels Staatsräson: Völkermord!« | Lokstedt | Zeug*in |
| 2/8/2024 | Störung der Jahresausstellungseröffnung der HfbK und Morddrohung gegen Besucher: »HFBK-Präsident Martin Köttering hatte gerade mit seiner Eröffnungsrede begonnen, als plötzlich Flugblätter durch die Eingangshalle flogen und eine Gruppe von circa zehn Menschen ›Free Palestine‹ (deutsch: Befreit Palästina) skandierte. Als jener Besucher sich daraufhin entschied, die Veranstaltung zu verlassen, und beim Hinausgehen mit den Worten ›from the Hamas Murders‹ (deutsch: von den Hamas-Mördern) auf die Rufe reagierte, wurde er von einem der Anwesenden mit dem Tod bedroht. Der Unbekannte hatte auf die Aussage des Besuchers mit der Drohung ›I will follow and kill you‹ (Ich werde dich verfolgen und töten) reagiert und sein Opfer damit erreicht.« | Barmbek-Süd | Abendblatt |
| 2/9/2024 | Verletzung eines Studierenden an der Uni Hamburg: »Ein jüdischer Studierender der Universität Hamburg [wurde] bei einem Handgemenge an der Hand verletzt. […] Nach Informationen des Abendblatts kam es zu dem Handgemenge wegen pro-palästinensischer Flugblätter, die in der Mensa verteilt worden waren. Der jüdische Studierende sammelte diese ein, der Flugblattverteiler konfrontierte ihn; es kam zum Streit, dann zum Gerangel – bei diesem Handgemenge wurde der Studierende an der Hand verletzt.« Der Betroffene wurde zudem als »Zionist« beschimpft. | Rotherbaum | Abendblatt; Zeug*in |
| 2/19/2024 | Heil Hitler‹-Schmiererei an Wand der Hauptausstellung der KZ-Gedenkstätte Neuengamme | Neuengamme | Mitteilung Gedenkstätte |
| 3/2/2024 | Beleidigung auf der Mönckebergstraße: »Dem Verurteilten wurde vorgeworfen, am 2. März 2024 auf der Mönckebergstraße die Teilnehmer einer Mahnwache für Israel u.a. als „Scheiß Juden“ beschimpft zu haben. Er wurde deshalb wegen Volksverhetzung und Beleidigung zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen verurteilt.« | Altstadt | Mitteilung Staatsanwaltschaft |
| 4/10/2024 | Transparent auf einer pro-palästinensischen Demonstration: »Free Gaza from Wiedergutmachung« | Zeug*in; | |
| 4/15/2024 | Antisemitischer und israelfeindlicher Shitstorm gegen den Veranstalter des unabhängigen Musikfestivals »Booze Cruise« | St. Pauli | Jungle World |
| 4/27/2024 | Islamistische Demo der Gruppe Muslim Interaktiv (Tarnorganisation der verbotenen Hizb ut-Tahrir) am Steindamm, u.a. Forderung nach einem Kalifat in Deutschland. | St. Georg | Zeug*in |
| 4/28/2024 | Zahlreiche Plakate der Partei DIE GRÜNEN mit »Zionismus = Faschismus« beschmiert | Eimsbüttel | Zeug*in |
| 5/2/2024 | Aktivist*in »Heal d Wrld« filmt als Instagram Reel in einem Edeka im Grindelviertel »Hass-Avocados« mit der Herkunft Israel. Das Preisschild ist mit »IsraHell« beschmiert und mit einem »Fuck Zionism«-Sticker beklebt. | Rotherbaum | Hamburger Initiative gegen Antisemitismus |
| 5/3/2024 | Graffito rotes Zieldreieck (Hamas-Propaganda) und Parole »All Eyes on Gaza« | St. Pauli | Instagram |
| 5/6/2024 | Einrichtung eines »Protest-Camps« auf der Moorweide (Nähe Universität) unter Beteiligung der palästinensisch-nationalistischen Gruppe »Thawra«. Aus dem Camp gehen bis September 2024 verschiedene antisemitische Aktionen hervor (siehe u.a. Eintrag »Tätlicher Angriff…« am 08.05.2024). Das rote Dreieck der Hamas-Propaganda ist immer wieder am Camp und im Umfeld zu sehen. | Rotherbaum | ZEIT; taz; Bürgerschafts-Drucksache 22/15817 |
| 7/5/2024 | Sticker mit dem Motiv eines Panzers: »Widerstand ist Leben. Panzer für Palestina.« | Mitte | Zeug*in |
| 5/7/2024 | Graffito der genozidalen Parole »From the River to the Sea« | Rotherbaum | Instagram |
| 5/8/2024 | Tätlicher Angriff auf ein Vorstandsmitglied der Deutsch-Israelischen-Gesellschaft nach einer Veranstaltung zu Antisemitismus an der Universität Hamburg; laut Presseberichten ist eine Täterin Mitanmelderin des „Protest-Camps“ | Rotherbaum | ZEIT |
| 5/8/2024 | Auf einer Kundgebung des linken »Bündnis 8. Mai« auf dem Rathausmarkt wird eine Teilnehmerin, die ein Plakat hochhält (»Bring them home now«) von Menschen aus dem »Jugendblock« (bei dem auch »Young Struggle« mitläuft) angegriffen. Ihr Plakat wird ihr aus den Händen gerissen. Auch ein Antifaschist, der zu vermitteln versucht, wird beiseite gedrängt. Die Kundgebungsleitung bedauert den Zwischenfall. | Altstadt | Zeug*in |
| 5/11/2024 | Islamistische Demo der Gruppe Muslim Interaktiv (Tarnorganisation der verbotenen Hizb ut-Tahrir) am Steindamm, u.a. Forderung nach einem Kalifat im Nahen Osten (ca. 2300 Teilnehmer) | St. Georg | Hagalil |
| 5/13/2024 | Auf das Graffito einer palästinensischen Fahne wurde »Islamic Jihad muss sein« geschmiert | Rotherbaum | Instagram |
| 5/14/2024 | Aktion vor dem autonomen, besetzten Zentrum Rote Flora, gestreamt und beworben von pro-russischen, pro-islamistischen Medienkanälen (RedStream; Salah Said). Legitimiert wird die Aktion mit einer grundsätzlichen Ablehnung der Antisemitismuskritik, die von der Roten Flora zu verschiedenen Anlässen formuliert wurde. Diese wird als »antideutsch« diffamiert. | Sternschanze | taz |
| 5/14/2024 | Plakat im »Protest-Camp« Moorweide (»Zionism is Racism is Fascism«) | Rotherbaum | ZEIT/Elbvertiefung Newsletter |
| 5/14/2024 | Aufkleber zur Erinnerung an israelische Geisel mit »Israel Terror« beschmiert | Mitte | Instagram |
| 5/15/2024 | »Nakba«-Demonstration unter Beteiligung der palästinensisch-nationalistischen Gruppe Thawra. Laut ZEIT bleiben bei den Reden »die Opfer des Terroranschlags vom 7. Oktober unerwähnt. Auf der Bühne ist immer wieder von ›Besatzung, Kolonialisierung und Genozid‹ die Rede. Einmal wird Israel als ›genozidaler Staat‹ bezeichnet.« | St. Georg | ZEIT |
| 5/15/2024 | Antisemitische Parolen auf dem Campus der Hochschule für angewandte Wissenschaften (HAW). Die Pressestelle der Universität schreibt: »Heute Morgen waren sie auf dem Campus am Berliner Tor zu lesen: Mit Sprühfarbe an den Mauern hinterlassene Parolen zum Krieg in Gaza mit antisemitischem Hintergrund. Die Sachbeschädigung wurde zur Anzeige gebracht, die Parolen dokumentiert, nun werden sie entfernt bzw. überstrichen.« | St. Georg | HAW |
| 5/18/2024 | Aufkleber mit rotem Dreieck angebracht | Mitte | Instagram |
| 5/18/2024 | Antisemitische Tafel des Künstlerkollektivs »New Red Order« in der Ausstellung »SURVIVAL IN THE 21ST CENTURY« in den Deichtorhallen. Bericht des NDR: »Auf einer Tafel neben dem eigentlichen Kunstwerk wird Israel die alleinige Schuld am Nahost-Konflikt gegeben und mit Nazi-Deutschland in eine Reihe gestellt. […] es ist nichts anderes als eine antisemitische Verschwörungserzählung, die da in der Ausstellung hängt. Der Massenmord an den Indigenen in den USA, die Shoa in Nazideutschland und die israelische Politik von heute seien strukturell alles dasselbe. Israel trage allein die Verantwortung für den Nahostkonflikt. Vom Hamas-Terror kein Wort. Von den iranischen Auslöschungsfantasien keine Silbe.« | Altstadt | NDR |
| 5/19/2024 | Antisemitisches und israelfeindliches Plakat in Planten un Blomen (»Zionismus = Kolonialismus, Rassismus, Terrorismus.«) | Mitte | Instagram |
| 5/20/2024 | Antisemitisches und israelfeindliches Plakat am Kulturzentrum B5 (»Israels Genozid, 83% der Grundwasserbrunnen […] zerstört.«) | St. Pauli | Instagram |
| 5/24/2024 | Pro-Palästina Aktivisten und Aktivistinnen hatten im Gebäude der Hochschule für bildende Künste (HfbK) antisemitische Graffitis und Plakate angebracht. Die Hochschule hat diese entfernt. | Barmbek-Süd | NDR/Meldung Hamburg Journal |
| 5/27/2024 | Kundgebung Thawra unter dem Motto »Israel sofort entwaffnen« bzw. »Boykottiert Israel« | St. Georg | Hamburger Initiative gegen Antisemitismus |
| 5/28/2024 | Instagram Story der Gruppe Thawra aus dem »Protest-Camp«, mit Aufkleber »Free Gaza from German Antifa!« | Rotherbaum | Hamburger Initiative gegen Antisemitismus |
| 5/30/2024 | Auf Instagram filmen sich Aktivist*innen von Thawra, wie sie im Auto über die Grindelallee fahren, aus den Seitenfenstern halten sie eine palästinensische Fahne, aus dem Autoradio tönt der Song »Free Palestine« vom Interpreten SEB!, in dem das Ende Israels herbeigesehnt wird. | Rotherbaum | Hamburger Initiative gegen Antisemitismus |
| 5/30/2024 | Holocaustleugnung an der Universität Hamburg: »Ein Mann soll auf dem Campus der Universität Hamburg volksverhetzende Äußerungen gemacht haben. Was bekannt ist. Im Internet kursiert ein Video des Vorfalls. Darauf ist zu hören, wie der Mann die Frage, ob er den Holocaust leugne, bejaht. In einer anderen Aufnahme sagt er, Adolf Hitler habe versucht, Juden zu schützen. Laut Pressestelle der Polizei ermittelt das Landeskriminalamt gegen ihn. Der Vorfall soll sich gegen Mittag vor dem Audimax der Universität ereignet haben. Auf Fotos von Studierenden ist zu sehen, wie der 43-Jährige mit drei Flaggen vor dem Gebäude steht: mit einer Israelflagge, einer Reichsflagge mit Davidstern und einer Fahne, auf der ein Eisernes Kreuz abgebildet ist. Eine Gruppe von Studierenden soll den mutmaßlichen Holocaustleugner angesprochen haben, dabei sei auch das Video entstanden, erklärt die Gruppe Students for Palestine Hamburg, die die Aufnahmen online verbreitet hat. Laut einer Pressesprecherin der Polizei wurde der Mann von Studierenden angezeigt.« | Rotherbaum | Eimsbütteler Nachrichten |
| 6/2/2024 | Ehrenamtlicher Guide der Stiftung Historische Gedenkstätten und Lernorte berichtet von antisemitischen Äußerungen einer Besucherin in der Gedenkstätte Fuhlsbüttel | Fuhlsbüttel | Mitteilung Gedenkstätte |
| 6/3/2024 | Transparente mit roten Zieldreiecken (der Hamas-Propaganda) sowie »Yallah Intifada« am »Protest-Camp« Moorweide | Rotherbaum | Instagram |
| 6/6/2024 | Michel Abdollahi suggeriert als Moderator auf einer auf Kampnagel-Veranstaltung zu »Canceln und Boykott« eine proisraelische Lobby in Deutschland, die eine mccarthyistische Diskursverengung betreibe. Raunt verschwörungsideologisch, dass Theatermacher im Fokus einer »politischen Kampagne« stünden »weil bestimmte Institutionen Sorge haben, dass hier etwas apassiert, was ihnen nicht passt«. Jeder Protest dagegen würde als antisemitisch diffamiert etc. Die israelsolidarische Kundgebung gegen Zamzam Ibrahim vom 25.01.2024 auf Kampnagel bezeichnet er als »Neonazis in Israelfahnen«. | Winterhude | Zeug*in |
| 6/8/2024 | Thawra Aktivist »einfach_tarik« markiert Olaf Scholz in Instagram Story mit rotem Dreieck; schreit ihm »Kindermörder« zu | online | Hamburger Initiative gegen Antisemitismus |
| 6/9/2024 | Instagram Story von Students4palestinehh dokumentiert »Zionism = Racism« Graffiti an der UHH Gebäude | Rotherbaum | Hamburger Initiative gegen Antisemitismus |
| 6/13/2024 | Sticker zur Erinnerung an die Geiseln in Gaza wurde mit Sticker »Jüdische Stimme – Juden gegen Genozid« überklebt | Mitte | Hamburger Initiative gegen Antisemitismus |
| 6/26/2024 | Unangemeldete Demonstration gegenüber dem Eingang Ostflügel Hauptgebäude UHH gegen die dort stattfindende Veranstaltung zu »Antisemitismus & Kampf gegen Antisemitismus aus jüdischer Perspektive«. Teilnehmende rufen lautstark Parolen, u.a. »Unsere Kinder, Frauen, Männer wollen leben – Uni Hamburg ist dagegen« und »Gegen Zionismus – gegen Faschismus«. | Rotherbaum | Zeug*in |
| 6/26/2024 | Störungen der Veranstaltung »Antisemitismus & Kampf gegen Antisemitismus aus jüdischer Perspektive«: »Offenbar hatten sich im Hörsaal mehrere Aktivisten verteilt. Bei sich trugen sie kleine Lautsprecherboxen, aus denen sie dann – einer nach dem anderen – etwas abspielten. Ob es sich dabei um Parolen handelte, sei kaum zu verstehen gewesen, erzählt die schon erwähnte Besucherin, die ebenfalls anonym bleiben möchte. ›Es war in erster Linie laut und plärrend.‹ Immer wieder habe die Veranstaltung unterbrochen werden müssen. Die von der Universität engagierten Sicherheitsleute hätten einen Störenden nach dem anderen aus dem Saal geführt. Dann sei etwas geschehen, das für einen ›Schreckmoment‹ im Publikum gesorgt habe: In den Reihen seien zwei Männer mit Palästinensertüchern aufgestanden und langsam nach vorne gegangen. Dort hätten sie sich in der ersten Reihe neben einem weiteren Aktivisten niedergelassen – direkt vor dem Rednerpult. Einige im Publikum hätten gerufen: ›Jenny, pass auf!‹ Es sei eine ganz offensichtliche Drohgebärde gewesen, so die erwähnte Besucherin gegenüber dem Abendblatt.« Die Sicherheitsleute hätten sich dann nahe bei den drei Männern postiert. Diese seien sitzen geblieben. Die sich an den Vortrag anschließende Gesprächsrunde habe einer der Männer mit Zwischenrufen gestört. Als die Veranstaltung endete, seien einige Besucher gebeten worden, den Saal über einen Seiteneingang zu verlassen.« (Abendblatt) | Rotherbaum | Abendblatt |
| 6/26/2024 | Einer Person, die ein T‑Shirt mit hebräischer Aufschrift trägt, wird am Dammtorbahnhof von einem Mann mehrmals der Hitlergruss gezeigt. | Rotherbaum | Betroffener |
| 6/28/2024 | Plakate zur Erinnerung an Hamas Geiseln wurden abgerissen und beschädigt | Ottensen | Zeug*in |
| 7/1/2024 | Aufkleber »Bring them home to Europe! Decolonize Palestine« (auf rotem Dreieck) | Eimsbüttel | Instagram |
| 7/3/2024 | Demonstration Haupteingang Universität, nähe Vorlesungsreihe zu Judenfeindschaft | Rotherbaum | Zeug*in |
| 7/8/2024 | Rotes Dreieck auf dem »Thawra Kalender« (Instagram) | Rotherbaum | Instagram |
| 7/10/2024 | Demonstration Haupteingang Universität, nähe Vorlesungsreihe zu Judenfeindschaft; ca. 150 Personen; Parolen u.a. »Gegen den Faschismus! Gegen Antisemitismus! Gegen Zionismus!« | Rotherbaum | Zeug*in |
| 7/15/2024 | Angriff, antisemitische Beleidigung: »Die 56 Jahre alte Fußgängerin hatte sich über die Radfahrerin, die auf dem Gehweg fuhr, geärgert und sie angesprochen. Der Polizei sagte sie später, die Radfahrerin habe sie daraufhin zunächst antisemitisch beleidigt. Und dann nach ihrer markanten Halskette gegriffen und sie gewürgt. Die Radfahrerin soll auch noch auf die bereits am Boden liegende Fußgängerin eingetreten haben.« (NDR) | Bahrenfeld | NDR |
| 7/17/2024 | Demonstration von Thawra von der Roten Flora nach Altona; auf Transparenten steht u.a.: »Intifada Generation«, »Das einzig rote an der Flora ist das Blut an ihren Händen«. | Sternschanze | Instagram; Abendblatt; Zeug*innen |
| 7/17/2024 | Eine Kundgebung gegen die zuvor genannte Demo (Rote Flora nach Altona) wird attackiert. Ein Mann versucht, eine Israel Fahne zu erobern, stürzt sich zwischen die TN der Kundgebung und verletzt TN. Er wird von der Polizei, die die Kundgebung absichert, festgenommen. | Sternschanze | Zeug*in |
| 7/26/2024 | Graffiti »Free Gaza« und Hammer und Sichel an einem von orthodoxen Juden bewohnten Haus | Eimsbüttel | Instagram; Auskunft Zeug*in |
| 7/26/2024 | Schmiererei an der Meinungswand der Hauptausstellung der KZ-Gedenkstätte Neuengamme: »Man muss wohl die Öfen wieder anschmeißen« | Neuengamme | Mitteilung Gedenkstätte |
| 8/3/2024 | Auftritt der u.a. antisemitischen, verschwörungstheoretischen Deutsch-Rap-Crew »Rapbellions« in Bramfeld | Bramfeld | Instagram |
| 9/19/2024 | In einem Aufruf von »ahrar.de« (Instagram) zu einer Demonstration am 5. Oktober wird das Massaker vom 7. Oktober relativiert und gerechtfertigt, Israel dämonisiert, die Zerstörung Israels gefordert (»Wir werden nicht aufhören, wir werden nicht ruhen, bis jeder Zentimeter Palästinas frei ist.« | Altstadt | Instagram |
| 10/5/2024 | Palästinensisch-nationalistische »Massendemonstration« nach Aufruf von »ahrar.de« (siehe Eintrag 19.09.2024); u.a. Plakat »Deutsche Staatsräson: Palästinenser und Libanesen müssen heute für die deutschen Verbrechen von damals büßen. WARUM???« | Altstadt | Zeug*in |
| 10/5/2024 | Während der palästinensisch-nationalistischen »Massendemonstration« versuchen ca. 20 junge Männer zur »Mahnwache für Israel« durchzubrechen, wird von der Polizei verhindert, Ordner greifen ein | Altstadt | Zeug*in |
| 10/5/2024 | Im Umfeld der palästinensisch-nationalistischen »Massendemonstration« werden Sticker mit dem Davidstern in den ein rotes Dreieck integriert ist und der Aufschrift »Liberate Judaism from Zionism»gefunden | Altstadt | Instagram |
Anhang – Erläuterungen
Beispiel 1:
| 18.10.2023 | Am Mittwoch sind in der Hamburger Innenstadt erneut pro-palästinensische Demonstrierende auf die Straße gegangen. Unterdessen wurde das Verbot solcher Kundgebungen bis Sonntag verlängert. Auf dem Jungfernstieg hatten zunächst etwa 20 Menschen gegen die Angriffe Israels protestiert – unter anderem mit Pappplakaten auf denen eine Wassermelone zu sehen war, das altbekannte Zeichen der Palästina-Proteste. Vier junge Männer wurden von der Polizei in Gewahrsam genommen, wie NDR 90,3 berichtete. Laut Augenzeugen sollen sie zwei Palästina-Flaggen mit dem Abbild des irakischen Diktators Saddam Hussein gezeigt haben.« | Altstadt | NDR |
|---|
In diesem Fall stehen uns keine ausreichenden Informationen für eine Kategorisierung zur Verfügung. Es ist aller Erfahrung nach wahrscheinlich, dass es im Rahmen dieser sog. pro-palästinensischen Kundgebung zu diesem Zeitpunkt zu Israel dämonisierenden, antisemitischen Aussagen kam; das Zeigen eines Bilds des ehemaligen irakischen Diktators Saddam Hussein, der 1991 im Rahmen des zweiten Golfkriegs Raketen auf Israel – das keine Kriegspartei darstellte – abfeuern ließ, kann so interpretiert werden. Kundgebungen stellen ein demokratisches Grundrecht dar. Wir folgen der Systematik der Recherche und Informationsstellen Antisemitismus (RIAS) und ordnen entsprechende Versammlungen nur als antisemitische Versammlungen ein, wenn „in Reden, Parolen, auf mitgeführten Transparenten oder in Aufrufen antisemitische Inhalte festgestellt“ werden. In diesem Fall „wird die gesamte Versammlung als ein antisemitischer Vorfall vom Typ verletztendes Verhalten registriert. Ereignen sich bei oder am Rande einer solchen Versammlung Angriffe oder Bedrohungen, so werden diese jeweils als zusätzliche antisemitische Vorfälle
dokumentiert.“ (RIAS 2024)
Beispiel 2:
| 20.10.2023 | Israelfeindliche, terrorrelativierende Aussage gegenüber NDR Kamerateam: »Israel hat zuerst Palästina angegriffen und Palästina hat sich verteidigt, meiner Meinung nach.» | St. Georg | NDR |
|---|
Dieser Fall wurde von uns nicht als antisemitisch kategorisiert. Die im Interview mit dem NDR getätigte Aussage kann plausibel als Rechtfertigung antijüdischer Aggression und des Massakers vom 7. Oktober interpretiert werden. Allerdings stehen uns nicht genügend Informationen (insbesondere zum Gesprächsverlauf und ‑kontext) zur Verfügung, die eine seriöse Entscheidung absichern würden. In der ethnozentristischen Wahrnehmung zweier homogener Kollektive („Israel hat…“, „Palästina hat…“) liegt eine Logik absoluter Feindbestimmung, die auch ein Element des Antisemitismus darstellt.
Beispiel 3:
| 26.07.2024 | Graffiti »Free Gaza« und Hammer und Sichel an einem von orthodoxen Juden bewohnten Haus | Eimsbüttel | Zeug*in |
|---|
Dieser Fall wurde als antisemitisch eingeordnet. Es handelt sich um eine (gezielte) Sachbeschädigung, d.h. „die Beschädigung oder das Beschmieren jüdischen Eigentums“ (RIAS 2024). Obwohl der Gehalt der Schmierereien selbst nicht antisemitisch ist, werden hier praktisch deutsche Bürger:innen jüdischen Glaubens für ein (vermeintliches) Handeln des israelischen Staats verantwortlich gemacht. Auch dieser Vorfall illustriert exemplarisch, wie Antisemitismus als ein kulturelles Klima von Bedrohung und Ausschluss von Jüd:innen in Deutschland sowie der Rechtfertigung antijüdischer Aggression wirkt.
[1] Stellvertretend für alle engagierten Parlamentarier:innen sei hier die Arbeit von Cansu Özdemir und Deniz Celik (beide Mitglieder der Bürgerschaftsfraktion der Linkspartei) hervorgehoben, die durch ihre regelmäßigen Kleinen Anfragen dabei helfen, die notwendige Transparenz und Öffentlichkeit im Bereich Hasskriminalität herzustellen.
[2] Nach Mitteilung der Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hamburg arbeitet die Zentralstelle Staatsschutz mit der Arbeitsdefinition Antisemitismus der IHRA; entsprechende Bewertungen könnten sich allerdings im Laufe von Ermittlungen und Verfahren ändern.
[3] In diesem Zusammenhang weisen wir nochmals auf den an dieser Stelle vor einigen Wochen erschienenen Text „Klima der Judenfeindschaft“ zum Antisemitismus in Hamburg von Florian Hessel hin; die dort skizzierten Überlegungen Begriffe und Analysen formulieren einige der Grundlagen und Grundannahmen des vorliegenden Chronikprojekts aus und geben weitere Literaturhinweise.
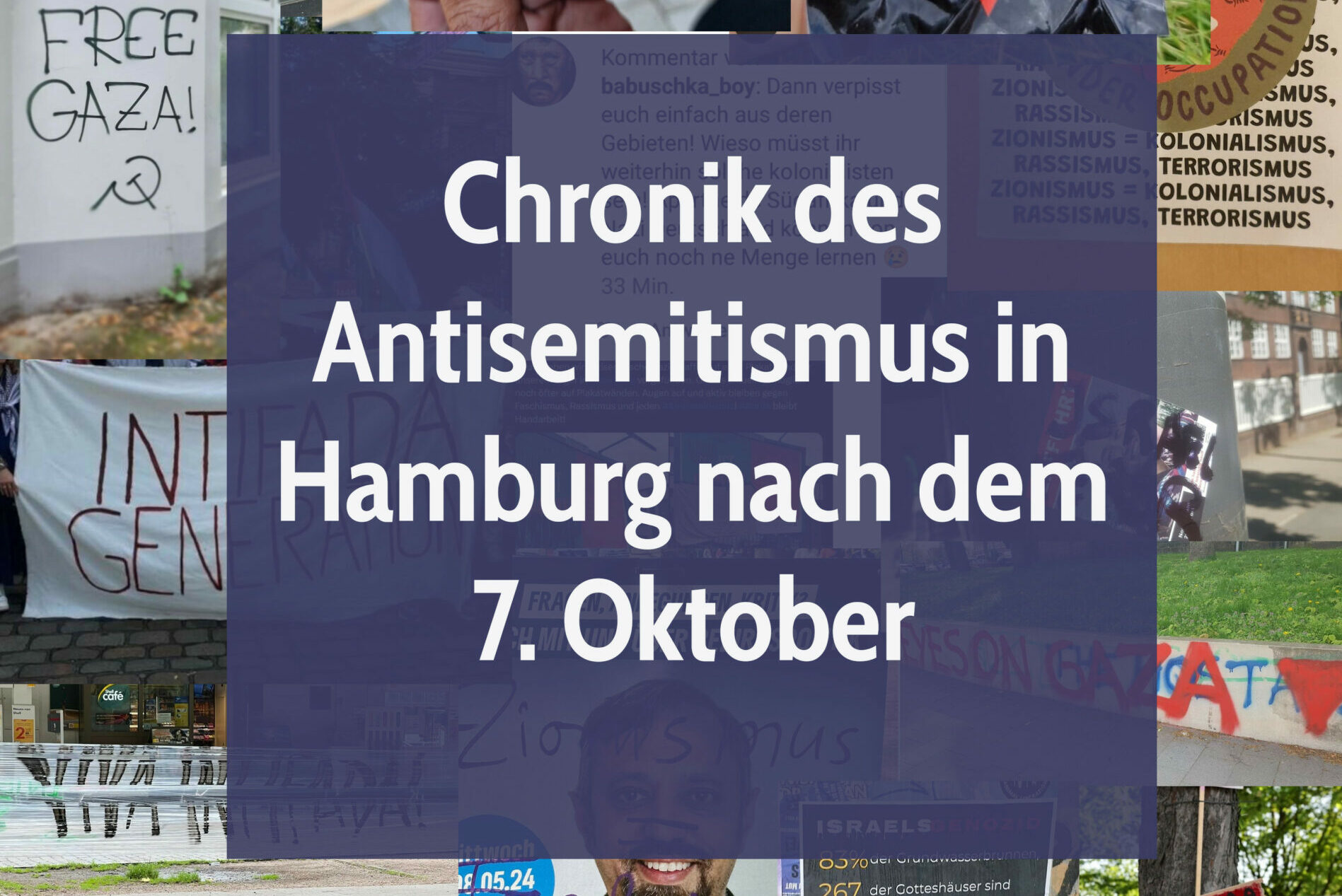
2 Kommentare