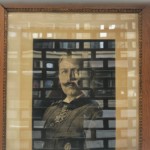Im Schatten des Elbtowers
In der HafenCity entsteht momentan das dritthöchste Gebäude Deutschlands. An dem Prestigeprojekt »Elbtower« offenbart sich die enge Verflechtung von Wirtschaft und Politik in Hamburg – und die besondere Rolle, die der ehemalige Bürgermeister Olaf Scholz dabei spielt.

Hamburg wäre nicht Hamburg, wenn nicht alle paar Jahre irgendein neues, großartiges Bauprojekt um die Ecke gebogen käme. Aber wo so viel Licht ist, wie bei den Lobpreisungen des Elbtowers, gibt es auch Schatten. Die stadtpolitische Durchsetzung solcher Projekte erweckt den Eindruck, als wäre der alte Hamburger Filz noch immer in bester Verfassung.
Der Elbtower sieht, den Stararchitekt:innen von David Chipperfield zum Dank, so aus, als hätte ein Märchenriese seinen zu großen Stiefel in Hamburg stehen gelassen. Im Schatten dieser »Ouvertüre« der HafenCity stehen Aktiengesellschaften, ihre Stiftungen, der heutige Finanzminister Olaf Scholz und – nicht zu vergessen – die Bewohner:innen von Rothenburgsort.
Prestigeprojekt durchgewunken
Diesmal scheint alles perfekt zu sein. Hamburg hat Europas größtes Bauprojekt angeleiert. Top Lage in der Hafencity, direkt an der neuen S‑Bahn-Station Elbbrücken, und das Megaprojekt soll sogar nachhaltig sein – was auch immer das bei einem Projekt dieser Größenordnung heißen mag: Platinstandard des HafenCity-Umweltzeichens.1Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, Schriftliche Kleine Anfrage des Abgeordneten Jörg Hamann (CDU) vom 07.09.18 und Antwort des Senats. Drucksache 21/14277, 14.09.2018. [online]. Das dritthöchste Gebäude Deutschlands kann »endlich« gebaut werden.
Die Auslobung des Elbtowers fand Mitte 2017 statt. Anfang 2021 ist der Bebauungsplan schließlich durchgewunken worden. Der Tower wird 245 Meter hoch und damit noch zwölf Meter höher als ursprünglich geplant. Oder wie die geneigten User:innen von ScyscraperCity-Foren es sagen: »[D]a kann man Hamburg nur neidvoll gratulieren! 😊«.
Im Gegensatz zur Fangemeinde phallusartiger Denkmäler und Weltwunder des Kapitalismus werden die Rothenburgsorter:innen im wortwörtlichen Schatten des Elbtowers leben. Die Anzahl der Einwände und Beschwerden, die bei der Kommission für Stadtentwicklung vorgebracht wurden, fiel mit überschaubaren 26 dabei ziemlich niedrig aus. Rothenburgsort weist einen hohen Anteil von Migrant:innen, Sozialhilfeempfänger:innen und Alleinerziehenden auf. Dass die Kritik am Elbtower so schmal ausfällt, könnte damit zusammenhängen, dass die subalternen Klassen in Hamburg nicht gehört werden.
Wackelige Finanzierung
Den Zuschlag für den Bau des Gebäudes bekam die Signa Prime Selection AG. So wurden weder die Bestbietenden ausgewählt, noch bekam ein Gebäudeentwurf den Zuschlag, der voll auf Klimaneutralität setzte. Die Aktiengesellschaft erhielt vielmehr den Zuschlag, weil sie der verlässlichste Geschäftspartner sei. Das sagt zumindest René Benko, der österreichische Gründer von Signa Prime. Und auch Olaf Scholz begründete die Vergabe seinerzeit damit, dass die Signa sehr finanzstark sei und ein A+ Rating innehat.
Es geht schließlich um (nach aktueller Planung) 700 Millionen Euro für den Bau. Die Signa möchte den Turm komplett aus eigener Tasche finanzieren – mit Büromieten um die 28 Euro pro Quadratmeter. Mindestens fünf Jahre soll das Unternehmen für die Instandhaltung des Gebäudes aufkommen. Für die Stadt Hamburg gebe es »kein Risiko«, behauptet Jürgen Bruns-Berentelg, Vorsitzender der Geschäftsführung der stadteigenen HafenCity Hamburg GmbH.2Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, Protokoll/Wortprotokoll der öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses, 22. Oktober 2018, S. 15 [online]. Das ist allerdings gar nicht so einfach nachzuvollziehen. Denn große Teile des Kaufvertrags sind, wie Heike Sudman von der Linksfraktion festgestellt hat, geschwärzt und somit für die Bürger:Innen Hamburgs nicht einsehbar. Was passiert, wenn dem Unternehmen das Geld ausgeht, wird noch diskutiert. Allerdings wäre es aus Sicht der Stadt wohl unsinnig, das Projekt nicht fortzuführen, wenn etwa ein 120 Meter hoher, nicht fertiggestellter Turm dasteht. Ganz abwegig ist es nicht, dass es zu finanziellen Problemen kommen wird. Das Mutterunternehmen Signa Holding ist auch Eigentümerin von Karstadt – und die gehen bekanntlich gerade insolvent. Des Weiteren macht das Unternehmen es fast unmöglich, einzusehen, woher es welche Gelder für welche Projekte bezieht.

Hamburger Filz
Bei der Vergabe des Bauprojekts hatten alle Bürgermeister der letzten Jahre einen Auftritt. Christoph Ahlhaus, der in seiner kurzen Amtszeit kein Großprojekt durchsetzen konnte, hatte sich mit seinem eigenen Immobilienunternehmen beworben. Zu mehr hat es dann aber auch nicht gereicht. Ole von Beust – hauptverantwortlich für den Bau der Elbphilharmonie – hat inzwischen ein Beratungsunternehmen, welches einen Beraterauftrag von der Signa innehat. Von Beust trat, selbstbekennend, als Lobbyist für die Signa im Zuge des Elbtower-Projekts auf.
Unter den Beratern der Signa finden sich neben Ole von Beust dann auch (alte) Genossen von Olaf Scholz: Alfred Gusenbauer (SPÖ) war von 2008 bis 2009 österreichischer Bundeskanzler und tut sich seit seinem Rücktritt als umtriebiger Lobbyist hervor, etwa für den kasachischen Diktator Nursultan Nasarbajew. Zu Scholz steht er in guten Beziehungen. Das schreibt Olaf Scholz zumindest in seinem Buch Hoffnungsland.
Gusenbauer (Team Benko) und Scholz (Team Hamburg) waren im gleichen Zeitraum in der International Union of Socialist Youth (IUSY) aktiv, einem internationalen Zusammenschluss verschiedener sozialdemokratischer und sozialistischer Jugendorganisationen, dem auch die Jusos und die Falken angehören. Gusenbauer war bis 1989 einige Jahre Vizepräsident der IUSY, genau wie Scholz. Von seinem Netzwerk aus dieser Zeit profitiert Scholz heute noch, worüber er jedoch ungern redet.
Wirtschaft und Politik
Die Verflechtungen von Politik und Unternehmen werden besonders an politischen Stiftungen deutlich. Sie dienen der Machtakkumulation auf beiden Seiten: Die Stiftungsunternehmen erhalten eine starke Interessensvertretung. Den Mitgliedern der Stiftungen, die in der Politik aktiv sein können, winken dagegen gut bezahlte Aufsichtsratsposten und Rückendeckung bei Entscheidungen von den Stiftungsunternehmen.3vgl. Marc Eulerich/Martin K. Welge, Die Einflussnahme von Stiftungen auf die unternehmerische Tätigkeit deutscher Großunternehmen, Düsseldorf 2011, S.73ff. [online].
So ist auch Olaf Scholz seit 2018 geborenes Mitglied des Kuratoriums der RAG-Stiftung. Sie ist Teilhaberin am KaDeWe, einem Tochterunternehmen der Signa Holding. Weitere fünf Prozent hält die Stiftung seit 2017 an der weiteren Tochter Signa Prime, die den Elbtower baut. Die Anteile an den Unternehmen, haben der RAG-Stiftung dieses Jahr bereits einen kleinen »Geldregen« beschert, was noch einmal aufzeigt, dass die RAG davon profitiert, wenn es der Signa gut geht. Und Prestigeobjekte wie der Elbtower sind meistens gut für das Geschäft.
Wenn die RAG-Stiftung durch ihre Beteiligungen an Unternehmen wie der Signa Prime also Dividenden einkassiert, im Fall der Signa in Höhe von vier Prozent, ist das nicht nur für die Stiftung und die Stiftungsunternehmen gut. Vielmehr kann die RAG mithilfe dieses Geldes ihre Marktmacht steigern, sich an mehr Unternehmen beteiligen und mehr Unternehmen als Stiftungsunternehmen aufnehmen. By the way: Armin Laschet, Peter Altmaier, Norbert Lammert und Heiko Maas sind ebenso Mitglieder des RAG-Kuratoriums.
Das bedeutet für die Stiftungsmitglieder im Kuratorium ein wachsendes Netzwerk von Unternehmen, mit denen sie zusammenarbeiten können. Die RAG und die in ihr organisierten Unternehmen erhöhen so ihre Einflussmöglichkeiten auf die Politik. Die Stiftung sieht ihren Aufgabenbereich hauptsächlich im Bereich des Steinkohlebergbaus in NRW – dahin fließt also ein Teil des Gewinns aus den Dividenden der fünf Prozent Anteile an der Signa, die einen klimafreundlichen Turm in Hamburg bauen möchte: in den Kohlebergbau.
Chefsache
Der Tower wird nicht nur Höhepunkt der Hafencity, sondern gleich das mit Abstand höchste Gebäude der Stadt. Dementsprechend motiviert und emotional soll Scholz schon bei der Präsentation des Gebäudes gewesen sein. »Hervorragend«, »elegant«, »raffiniert«, waren die Begriffe, die Scholz zur Beschreibung des Projekts wählte. Als Scholz noch in Hamburg weilte, nahm er sich des Projekts daher auch persönlich an; machte es zur »Chefsache«, wie die lokale Presse schrieb, und verdonnerte den Oberbaudirektor und die Stadtentwicklungssenatorin auf die billigen Plätze.
Parteigenossen von Scholz haben der MoPo zufolge gefrotzelt: »Kleiner Mann, großer Turm.« Aber lassen wir uns vom Napoleon-Komplex nicht beirren. Es war nicht Olaf Scholz’ Körpergröße, die zu der zwielichtigen Vergabe des Bauauftrags führte. Aber mit dem Baubeginn 2021 wird Scholz ein Denkmal gesetzt. Das offenbart eher einen »Cheops-Komplex«, der sich an die ägyptischen Pyramiden zum Zweck der Machtdemonstration anlehnt. Immerhin wird die Elbphilharmonie dann nicht mehr der unangefochtene Höhepunkt der Stadt sein.
Scholz setzte das Projekt mit viel Krafteinsatz durch und tat dies »mit einem guten Gewissen«, denn, so seine bestechende Argumentation, das Ergebnis werde sehr gut sein. Falls das Ergebnis nicht »sehr gut« wird, sollten wir ihn besser an sein Engagement erinnern. Immerhin ist seit seinem Einsatz für die Warburg Bank in Hamburg hinlänglich bekannt, dass der Herr Finanzminister Probleme mit der Erinnerung hat, wenn es um größere Geldsummen geht.
Joe Chip
Der Autor hat zwölf Jahre im Hafen gearbeitet, der Arbeit den Rücken gekehrt und Soziologie studiert. Als Gewerkschafter bleibt er mit den besitzenden Klassen in Verbindung. Seine Erfahrungen verarbeitet er in Kurzgeschichten und Polemik.
- 1Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, Schriftliche Kleine Anfrage des Abgeordneten Jörg Hamann (CDU) vom 07.09.18 und Antwort des Senats. Drucksache 21/14277, 14.09.2018. [online].
- 2Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg, Protokoll/Wortprotokoll der öffentlichen/nichtöffentlichen Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses, 22. Oktober 2018, S. 15 [online].
- 3vgl. Marc Eulerich/Martin K. Welge, Die Einflussnahme von Stiftungen auf die unternehmerische Tätigkeit deutscher Großunternehmen, Düsseldorf 2011, S.73ff. [online].